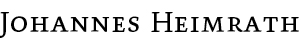Manchmal hat man Gesichte, die einen fernen Lebenszustand vorwegnehmen. Man weiß: Alles wird so kommen. Aber man weiß nicht, warum einem die Sicht in die längst auf einen zumahlende Wirklichkeit gegeben wird. »Geschenkt« wäre hier das falsche Wort, denn solche Vorwahrnehmung belastet, sobald sie Gegenwart wird und sich nicht alles genauso anfühlt wie damals. So etwas habe ich als Fünfzehnjähriger erlebt: Eines Abends sah ich, wie ich als Vierzig-, Fünfzigjähriger in einer Art freien Universität lebe, umgeben von offenen, strahlenden Menschen, die in all ihrer Fehlerhaftigkeit durch und durch gut sind, einander durch alle Konflikte hindurch ganz und gar zugetan bleiben, im Bewusstsein all ihrer Schatten von innen heraus leuchten und mit den besten Fähigkeiten des Menschen in aller Holperigkeit an dem arbeiten, was ihnen als Aufgabe in dem Lebensnetz, das unsere Planetin umspannt, aufgegeben ist.
Jetzt bin ich sechzig – und folge noch immer dieser schlichten Vision. In ihrer sichtbaren Ausprägung ist sie in vielen Aspekten weit von dem klaren Bild entfernt, als das sie mir damals erschienen war. In ihrer Essenz jedoch ist sie wahr geworden. Eines der Rätsel, die ich mit mir trage, ist dies: Wie konnte es geschehen, dass mir – der ich jener Vision konkret gefolgt bin, ohne sie als »Mission« zu empfinden – tatsächlich Menschen begegneten, deren je eigenständiges Mit-mir-zusammen-ihren-Weg-Gehen die Verwirklichung des Gemeinsamen überhaupt erst möglich gemacht hat? In jenem Bild war ich kein »Leader«, kein Guru, keine sonstwie prophetische oder »tolle« Person. Ich war lediglich glücklich darüber, gleichwürdiger Teil einer Gemeinschaft von höchst differenzierten Persönlichkeiten zu sein, Menschheitsmensch unter Menschheitsmenschen gewissermaßen. Und obwohl ich in der seither entstandenen Gemeinschaft derjenige sein mag, der manches als erster in gewisser Tollkühnheit zu wagen anregt, habe ich stets verstanden, dass auch dies – wie das Zurückhalten des Tollkühnen – nur eine der vielen gleichermaßen notwendigen Aufgaben ist, die in einer gedeihenden Lebensgemeinschaft erfüllt sein müssen. – Wie konnte sich mein Schicksal so folgerichtig entfalten, wo doch so viele andere Menschen mit all ihrem Eigen-Sinn, ihrer individuellen Selbstentfaltung, ihren von den meinen abweichenden Wünschen und ihrem ganz anderen Gemeintsein meinen Weg ebenso beeinflusst haben wie ich den ihren?
War es etwa genug, dass ich nicht so tun wollte, als wäre jener Augenblick der Wahrheit damals nicht gewesen? Habe ich womöglich nichts anderes zustande gebracht, als jener Wahrheit eine Behelfsunterkunft in meinem Herzen zu geben und seither zu forschen, was dieses Licht am Leben erhält, so dass es wärmt und nichts verbrennt, so dass es erhellt und nicht blendet, so dass es strahlt und nicht glänzt? – Ein zweites Rätsel bleibt dies: Obwohl ich in vielen dieser Dinge wohl unvollkommen bleiben werde und oft mangelhaft handle – wieso genieße ich dennoch die Zuneigung der Menschen, mit denen ich lebe?
Nehmen Sie mir den Schwulst nicht übel. Es muss der Frühling sein …
Herzlich, Ihr Johannes Heimrath (Herausgeber)
Hier geht’s zu Oya Ausgabe 25