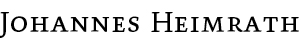Dass alles schlechter wird, scheint objektiv zuzutreffen – die Alarmsensoren im Cockpit unseres Weltallseglers Erde, die uns vor dem Verlassen des schmalen Bereichs der für uns Menschen geeigneten Lebensbedingungen warnen, piepsen jedenfalls unüberhörbar. Ich staune immer wieder darüber, wie wenig ausgeprägt unser subjektives Gefühl dafür ist, wie sehr uns – dich und mich persönlich – dies bedroht. Dass wir bald drei Stück Erden benötigen werden, wenn wir so weitermachen, scheint für die meisten Menschen eine irrelevante Information zu sein. So irrelevant wie der Hinweis, dass beispielsweise wir Deutsche derzeit die Lebensquellen von zweieinhalb Deutschländern ausbeuten, um unserem Lebensstil zu frönen – wobei die Bevölkerung der zusätzlichen anderthalb Deutschländer weder essen, sich kleiden, wohnen, atmen, ja nicht einmal da sein darf! Noch weniger bewegt sich in uns bei der Nachricht, dass Japan die Ressourcen von sieben Japanen verzehrt und die Vereinigten Arabischen Emirate gar mehr als zwölf Länder ihresgleichen benötigen, um über die Runden zu kommen. Das muss mit dem »unrealistischen Optimismus« zu tun haben: Ein altes Erbe in unseren Gehirnen bewirkt, dass wir uns stets als besser und weniger gefährdet einschätzen als alle anderen: Weil ich so klug/vegan lebend/vom Glück gesegnet bin, ist mein persönliches Risiko, an Krebs zu erkranken, pleitezugehen, mein Auto kaputtzufahren, einen Freeride heil zu überstehen, wegen Beziehungsproblemen depressiv zu werden usw. viel geringer als das der anderen, ja eigentlich praktisch null. Das Gute steht mir gutem Menschen zu, das Unglück trifft in der Regel die anderen, weniger guten.
Doch tatsächlich wird auch dich und mich – uns überdurchschnittlich Gute – das Schicksal derer, die unser Gehirn als weniger gut einstuft – also aller anderen –, ereilen: Noch kennt nicht einmal die oder der Allerguteste den Trick, der sie oder ihn von dieser Planetin auf die zweite, gleich nebenan im Weltall schwebende Erde beförderte. – Alle Bemühungen, die hiesige Welt »ein wenig besser« zu machen, führen ja nur zu einer etwas weniger schlechten Welt.
Kürzlich diskutierte ich das mit einem jungen Familienmitglied – und durfte dann in dem fertigen Essay, dessen Anfertigung für einen Jugendkongress Anlass zu unsem Gespräch war, lesen: »Ich möchte nicht für eine bessere Welt leben, sondern für eine gute. Wenn alle sich damit zufriedengeben, die Welt zu verbessern, werden wir nie zu einer guten Welt gelangen. Vielmehr muss jede und jeder das Gute selbst verkörpern und so handeln, dass es zur Richtschnur für jeden Menschen werden könnte.«
Erfreulich, nicht wahr? Womöglich ist die Jugend nicht gar so sehr vom unrealistischen Optimismus befallen wie die Generation der heutigen Weltkursbestimmer, denn der Text fährt fort: »Wann und ob es jemals eine gute Welt geben wird, in der jeder jeden akzeptiert und glücklich leben lässt, weiß ich nicht. Jedoch hoffe ich, dass die Zeit kommen wird und wir alle auf irgendeine Art Wegbereiter dafür sein dürfen.« – Ein Quantum Hoffnung wird mir vergönnt sein …
Herzlich, Ihr Johannes Heimrath (Herausgeber)
Hier geht’s zu Oya Ausgabe 32