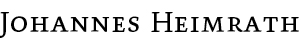Johannes Heimrath sprach mit Mathis Wackernagel, dem Gründer und Präsidenten des »Global Footprint Network«, über die Herausforderung, die Begrenztheit der irdischen Ressourcen zu begreifen.
Johannes Heimrath: Mathis, viele Diskussionen über den Rebound-Effekt vermitteln mir den Eindruck, dass die Forschergemeinde in folgenden Tenor einstimmt: Wenn wir so gut wie möglich aufpassen und Rebounds, so weit es geht, vermeiden, lässt sich mit Hilfe des technischen Fortschritts die Welt doch noch irgendwie retten. – Dabei fehlt mir immer schmerzhafter der dringende Hinweis darauf, dass es auf jeden Fall und vor allem anderen um ein »Weniger« an Maschinisierung und technischer Infrastruktur gehen muss, wenn wir uns den viel zu großen ökologischen Fußabdruck der Menschen in den Industrie- und den meisten Schwellenländern bewusstmachen. Ohne eine drastische Reduzierung des Konsums und entschlossene Rücknahme von Wachstum – mit all den damit verbundenen, voraussehbar harschen, Wandlungsprozessen – sehe ich keinen Weg, auf einen den planetaren Grenzen angemessenen Fußabdruck zu kommen.
Mathis Wackernagel: Ja; Ende des Interviews!
Scherz beiseite: Wie du sagst, sitzen wir in einer argen Falle. – Es war ja seinerzeit eine geniale systemische Einsicht von William Stanley Jevons, den Rebound-Effekt zu Beginn des fossilen Zeitalters zu erkennen: Könnte es sein, dass nützlichere und sparsamere Maschinen paradoxerweise dazu führen, dass der Ressourcenverbrauch insgesamt steigt? Die ersten Maschinen hatten nur den Zweck, Wasser aus den Kohleminen zu pumpen. Dann kamen die Menschen auf die Idee, sie auch für andere Dinge zu nutzen, wie Lokomotiven, Generatoren und so weiter. So stieg der Bedarf an fossiler Energie insgesamt. Das Interessante am Rebound-Effekt ist, dass er nicht vollständig erforschbar ist: Je weiter wir die Systemgrenze der Studie stecken, desto größer werden die Effekte – besonders, wenn Ressourcen und zugleich Geld gespart werden sollen. Untersuche ich beispielsweise nur das Konsumverhalten des Besitzers eines sparsameren Autos, so ist der Effekt klein, beziehen wir aber den Effekt auf die ganze Autoindustrie ein, kommen wir zu ganz anderen Resultaten. – Wie will ich empirisch belegen, was für Auswirkungen auf Konsum und Ressourcenverbrauch etwa die Einführung elektrischer Fensterheber in Autos hatte?
Aber eigentlich geben ja alle Ökonomen zu: Innovation und Effizienz kurbeln die Wirtschaft an – wieso brauchen sie dasselbe Argument, um zu behaupten, dass damit auch der Ressourcenverbrauch abnähme?
JH: Die Politik investiert unter dem Mäntelchen der ökologischen Nachhaltigkeit vor allem in »grüne Hochtechnik«. Ich kann jedoch an keiner Stelle erkennen, dass Gelder flössen, um echte Reduktion zu ermöglichen.
MW: Das mag ich nicht ganz so schwarzweiß behaupten. Wenn wir uns die sogenannte Energiewende anschauen, ist Deutschland durch sie eines der Länder, in dem der ökologische Pro-Kopf-Fußabdruck leicht abgenommen hat. Global gesehen – da hast du recht –, hat der Fußabdruck Deutschlands freilich noch längst kein verträgliches Maß angenommen. Er ist pro Kopf dreimal höher, als was es an Biokapazität in der Welt gibt, und etwa doppelt so hoch wie die Biokapazität Deutschlands selbst. Also: Ein übermäßig hohes Niveau wurde über Jahrzehnte hinweg um ein kleines bisschen abgesenkt. Aber den ökologischen Fußabdruck wirklich auf ein Niveau zu bringen, das global replizierbar ist, ohne völlig unvorhersehbare soziale, ökonomische und politische Folgen auszulösen, das braucht viel Hirn und Schweiß. Ich weiß, es geht für Einzelne, aber können wir ganz Deutschland transformieren, und das auch noch schnell genug? Und wenn wir es nicht können, was dann?
Ich bin darüber entsetzt, dass jungen Leuten, die Ökonomie studieren, heute noch beigebracht wird, dass wir als Menschheit auf einem Pfad von der Agrar- zur Industrie- und weiter zur Dienstleistungsgesellschaft seien und dass vor allem die letztere nicht mehr so ressourcenabhängig sei. Das ist ein Mythos: Die Dienstleistungsgesellschaften haben den höchsten ökologischen Fußabdruck!
JH: Ja, sie verlagern Teile ihrer Produktion in andere Länder und verbergen die dort erzeugte Erhöhung des Fußabdrucks in ihrer Umweltbilanz. Zum Glück gibt es euer Institut, das die wahren Zahlen ans Licht bringt.
MW: Zur Berechnung der ökologischen Fußabdrücke auf den Konsum: Wir zählen alle Exporte mit und ziehen Importe ab. Damit zeigt sich, wieviel Natur pro Kopf genutzt wird, um deren Konsum aufrechtzuerhalten.
Leider freuen sich nicht alle an unseren Ergebnissen. Unser Institut berechnet, wie sich seit 1961 der ökologische Fußabdruck der Menschen verändert und wie sich parallel dazu die Biokapazität der Erde entwickelt hat. Wir rechnen wie die Bauern: Wieviel brauchen wir (Fußabdruck), und wieviel haben wir (Biokapazität)? Beide Größen ändern sich Jahr für Jahr.
Zur Zeit wächst der Pro-Kopf-Verbrauch an Natur in Ländern mit rasch expandierenden Wirtschaften, etwa in China, am stärksten. Länder mit schnell wachsenden Bevölkerungen, wie zum Beispiel Kenia, haben hingegen einen schrumpfenden Pro-Kopf-Fußabdruck, weil sie sich die Ressourcen nicht leisten können.
In den letzten Jahrzehnten war die weltweite Bevölkerungszunahme pro Jahr relativ konstant – ein Nettowachstum von etwa 70 Millionen Personen pro Jahr. Die Geburtenrate insgesamt nimmt langsam ab, aber in vielen Teilen der Welt, die konservativer und religiöser werden, steigen die Geburtenraten. Das zentrale Thema des Bevölkerungswachstums wird leider von Kräften der politischen Rechten menschenfeindlich diskutiert und von der Linken dumm zum Tabu gemacht; dabei könnte es eines der frauen-, familien- und menschenfreundlichsten Themen sein: Wenn zum Beispiel jungen Frauen durch Förderung der Familienplanung viel stärker die Möglichkeit gegeben würde, in der Gesellschaft und am Wirtschaftsleben mitzuwirken, ließe sich das Bild drehen. Im Iran gab es nach dem Irak-Krieg viel zu viele Kinder, und dann wurde ein Gesetz erlassen: Wer heiraten wollte, musste an einem Kurs in Familienplanung teilnehmen. Dadurch sank die Geburtenrate in zwei Jahren so stark wie in China in 20 Jahren nicht. Aus religiösen Gründen will das die Regierung heute wieder rückgängig machen und stellt in den Städten Werbeplakate für das Gründen von Großfamilien auf. Aber noch nützt das nicht viel, die Katze ist doch aus dem Sack.
Eine langsam schrumpfende Weltbevölkerung hätte viele Vorteile. Und eine langsam wachsende wird uns zur Falle.
JH: Aber selbst wenn die Bevölkerung langsam schrumpfen würde, kämen wir mit einem sich weltweit explosiv verbreitenden Lebensstil nach westlichem Vorbild nicht auf einen verträglichen Fußabdruck! Alles deutet doch darauf hin, dass sich die ressourcenintensive Lebensweise der sogenannten Dienstleistungsgesellschaften weiter ausbreiten wird. Gibt es überhaupt Prozesse, die dich positiv stimmen?
MW: Ich denke viel darüber nach, wie sich soziale Transformation vollzieht. Das Ende des Kolonialismus, das Ende der Sklavenhaltung, die ersten Schritte der Frauenbewegung – jene Prozesse durchliefen jeweils ähnliche Phasen. Zuerst gab es ein paar Philosophen, die in kleiner Runde am Tisch diskutierten und moralische Pamphlete schrieben. Dann wurde die Bewegung etwas breiter, und schließlich wurden Kolonialismus, Sklaverei, Apartheid und Frauenunterdrückung auch noch ökonomisch unhaltbar. Es war auch wirtschaftlicher Druck, der die Sklaverei in den Vereinigten Staaten beendet hat – die Industriegesellschaft im Norden wollte Arbeiter, die man entlassen konnte, und keine Sklaven, die man ein Leben lang durchfüttern musste. Trotzdem ging das noch eine Zeitlang weiter, bis es zum Bürgerkrieg kam.
Ich frage mich, ob die ökonomische Einsicht, dass wir uns selbst mit dem überhöhten Ressourcenverbrauch das Kreuz brechen, nicht irgendwann kommen wird. Wolfgang Sachs hat mir mal gesagt: »We are in love with our obsessions!« – »Wir sind in unsere Obsessionen vernarrt!« Also nicht einmal ökonomische Realität genügt für den Wandel. Wir glauben weiter an das Wachstum, auch wenn es uns verarmt, und treiben seine absurden Mechanismen weiter an. Wie absurd das ist, mag weder die ökonomische Theorie noch die ökonomische Praxis heute anerkennen – aber es ist schon ökonomische Realität. »What’s the business case of destroying the planet on which we depend?«, fragt Paul Hawken. – »Welche Rendite soll es bringen, den Planeten, von dem wir abhängen, zu zerstören?«
Wenn die Weltpolitik ernsthaft sagt, wir wollen den Klimawandel unter zwei Grad Celsius halten, wird es schwer, noch Argumente für weitere fossile Energienutzung zu finden. Wir müssten bis 2050 komplett ausgestiegen sein – das ist die wissenschaftliche Übersetzung der Pariser Erklärung vom Dezember! Aber es wird in den Bau neuer Flughäfen investiert! Die Schweiz will einen zweiten Autotunnel durch den Gotthard bauen! Hinsichtlich des Zwei-Grad-Ziels ist das – ökonomisch betrachtet – eine totale Fehlinvestition!
JH: Auch der heutige globale Kolonialismus ist wirtschaftlich absurd – und nicht nur aus Perspektive des Klimavertrags! Auf slaveryfootprint.org habe ich mal ausgerechnet, dass für mich 26 Sklaven arbeiten – obwohl ich mir allergrößte Mühe gebe, meinen persönlichen Beitrag zur Steigerung des Rebound-Effekts und des Fußabdrucks minimal zu halten. Das ist nicht nett, und das führt wieder zurück auf meine eingangs gestellte Frage: Müssen wir nicht so etwas wie eine Reißleine ziehen und fragen: Freunde, wo können wir abbauen, statt weiterzuwuchern? Statt sogenannte Investitionen in Nachhaltigkeit zu tätigen, die letztlich die große Maschine weiter antreiben, etwas tun, das sie tatsächlich verlangsamt und langfristig zum Stehen bringt?
MW: Wir spielen ein geheimes Spiel, das niemand benennt, und wenn wir nicht zeigen, dass ein besseres Spiel möglich ist, wird es weitergespielt werden. Auf Englisch nennt sich dieses Spiel »Losing last« – »Sei derjenige, der zuletzt verliert«.
Meiner Erfahrung nach sehen alle, die auf der erfolgreichen Seite des heutigen Systems mitspielen, dass ein böses Ende naht. Also verstärken sie die Burgen, in denen sie sich verschanzt haben, und feuern damit die Negativspirale weiter an – hoffen aber, dass der angenehme Status quo so lange wie möglich erhalten bleibt und die eigene Burg die letzte sein wird, die das Spiel verliert …
JH: … während über die Hälfte der Weltbevölkerung längst auf der Verliererseite angekommen ist. Hast du irgendeine Idee, wie man aus dem Negativspiel aussteigen könnte?
MW: Ein Positivsummenspiel wäre denkbar. Dafür aber scheint es mir elementar wichtig zu sein, die Welt aus einer Ressourcensicherheits-Perspektive zu betrachten: Wieviel Welt gibt es pro Kopf? Wieviel brauchen wir heute pro Kopf? Wieviel hat Deutschland, wieviel braucht Deutschland heute? Letztlich gilt die Physik. Wir sollten eher an die physische Realität als ans Geld glauben, wenn uns die langfristige Sicherheit am Herzen liegt. Wollen wir wirklich immerzu mehr Natur ausgeben, als sie erneuern kann? Die Welt physikalisch zu betrachten, kann heilsam wirken; es verdeutlicht, wie sehr das Viel-Haben zum Risiko geworden ist.
JH: Du bist in der ganzen Welt unterwegs, um die Aufmerksamkeit für die Ressourcen-Perspektive zu erhöhen. Auf welche Strategien setzt du dabei?
MW: Ich möchte gerne eine einladende Vision für eine Welt mit einem Verbrauch, der ins Ressourcenbudget des Planeten passt, formulieren. Sie soll derart einladend sein, dass alle sagen: »Das ist wunderbar!« Aber viele leiten aus unseren Zahlen zwei mathematische Konsequenzen ab, die zum politischen Selbstmord führen: a) Wenn wir zu viel brauchen, müssen wir unseren Verbrauch herunterfahren – und das ist kein Wahlkampfthema, also politischer Selbstmord Nummer eins. Und – b) – es gibt viele, die mehr brauchen, um menschenwürdig zu leben. Also, da wir nicht expandieren können, müssen wir dann auch noch teilen – Ende des Wahlkampfs, politischer Selbstmord Nummer zwei. Vielleicht führt es zu einem produktiveren Weg, das aufzuzeigen: Wenn ihr die physikalische Realität nicht ernstnehmt, werdet ihr leiden! Ihr tragt das Riskio, nicht vorbereitet zu sein!
Vor bald 30 Jahren hatte ich mir ausgedacht, wie Wandel bewirkt werden könnte. Ich dachte, wenn wir es schaffen würden, dass alle Staaten die ökologische Krise als wirtschaftliches und politisches Risiko anerkennten, würden sie ihre Politik entsprechend ausrichten. Und siehe da! Seit dem 12. Dezember 2015 ist das so – das Klimaabkommen von Paris ist unterzeichnet! Doch erkenne ich auch meine Fehleinschätzung: Nun tun alle so, als sei nichts geschehen! Es waren nicht nur ein paar Wissenschaftler, die dort unterschrieben haben, nein, es waren alle Staaten, sogar Venezuela, Saudi-Arabien, Iran und China, die vom Öl stark abhängig sind. Alle sagen: Nie mehr als zwei Grad Erderwärmung! Wenn wir das nun ausrechnen, heißt das: Unser Kohlenstoff-Budget reicht bei heutigem Verbrauch nicht einmal mehr für 20 Jahre! Gleichzeitig stecken hinter jeder Kalorie, die wir hier in den USA essen, 7 bis 9 Kalorien Fossilenergie. Wir sitzen in einer enormen Zwickmühle, und das thematisieren wir kaum. Wären die Tageszeitungen zu einem Drittel mit Artikeln zu dieser Zwickmühle gefüllt, dann würde ich sagen, wir haben die Herausforderung begriffen.
Als wir 2003 das Global Footprint Network gegründet haben, setzten wir uns als Ziel, dass zehn Länder den ökologischen Fußabdruck offiziell als Teil ihrer Politik aufnehmen. In acht Jahren waren es zwölf Länder, die wir dazu gebracht hatten. Nicht, dass der Fußabdruck das Bruttoinlandsprodukt ersetzt hätte, aber er kommt immerhin in offiziellen Statistiken vor. Doch hat das irgendwelche Folgen? – Eine rhetorische Frage …
Hält es die Schweiz für ein Risiko, dass sie vier Schweizen benötigt, um ihren Ressourcenmetabolismus zu decken? Das Finanzministerium sagt, nein, wir haben wunderbare Schweizerfranken und geben eh schon zu viel für Nachhaltigkeit aus. Immerhin gibt es dort inzwischen einen Gesetzesvorschlag für eine grüne Wirtschaft, über die dieses Jahr abgestimmt wird. Der Vorschlag lautet, bis 2050 innerhalb der Grenzen der Erdressourcen zu leben. Die Journalisten schreiben, es sei unrealistisch, innerhalb der Kapazität eines Planeten zu leben, und bemerken nicht mal die Ironie darin.
JH: Das klingt nicht nach einer einladenden Geschichte! Wie müsste ein Klimavertrag gestaltet sein, damit für Länder wie die Schweiz oder Deutschland deutlich wird, dass sie ihren Verbrauch um zwei Drittel oder gar drei Viertel (!) reduzieren müssten, um ihn einzuhalten?
MW: Ja, wie lässt sich diese Botschaft attraktiv verpacken? – Für die Schweiz wäre es am besten, wenn sie innerhalb einer Welt, die sich selbst auffrisst, so wirtschaften würde, dass sie ihren Ressourcenstrom einigermaßen in den Griff bekäme und so ihren Kindern eine sichere Zukunft versprechen könnte. Solange sie das nicht kann – wozu haben wir überhaupt Pensionskassen?
JH: Ich denke an die beeindruckende Rechnung von Bill McKibben, derzufolge allein die heute an den Börsen gehandelten oder in Staatsbesitz befindlichen Werte an »ausbeutungsreifen« fossilen Energieträgern das, was zum Einhalten der Klimaziele maximal noch aus der Erde geholt werden dürfte, bereits um das Fünffache übersteigen: Glaubt irgendjemand daran, dass die Industrie den Gegenwert dieser Bodenschätze – der selbst bei heutigen Tiefpreisen 27 Billionen Dollar übersteigt! – etwa in der Erde lassen würde – gar freiwillig? Andersherum: Würden die Konzerne diese Öl-, Kohle- und Gasvorkommen tatsächlich nicht ausbeuten – würden wir also den tödlichen Extraktivismus in den nächsten 30 Jahren endgültig beenden –, so würden sämtliche Fertigungsketten der globalen Industrie zusammenbrechen. So oder so: Jeder Versuch, mir eine Zukunft mit den heutigen Industrien, ihren handfesten Interessen sowie ihren materiellen, technischen und ökonomischen Grundlagen vorzustellen – von ihrem gesellschaftsgestaltenden Diktat ganz zu schweigen –, endet vor einer Wand.
MW: Diese Argumentation beinhaltet aber auch die Gefahr, das Spiel »Losing last« zu zementieren. Könnten wir die Geschichte nicht so erzählen, dass alle gewinnen? Vielleicht in diesem Sinn: Nichts ist nur schwarz oder nur weiß, sondern vieles ist möglich?
Ich lebe hier in Kalifornien in einem alten Häuschen und komme im Alltag mit dem Fahrrad überall hin, wohin ich muss. Für 15.000 Dollar haben wir uns eine Solaranlage aufs Dach gebaut; damit ist der Strombedarf auch noch für die Generation meines Sohns gedeckt.
JH: Ich empfinde die Solartechnik inzwischen als zwiespältig. Auf den Dächern des ökologischen Gewerbehofs, der auch meine Gong-Manufaktur beheimatet, haben wir auf 3000 Quadratmetern Fotovoltaik installiert. Die Strecke bis zum Einspeisepunkt beträgt 150 Meter; sie wird von zwei armstarken Erdkabeln überbrückt. In jedem dieser Kabel stecken vier Aluminiumadern, jede so dick wie mein Daumen; deren Herstellung hat so viel Primärenergie verschlungen, dass die Anlage mehrere Jahre laufen muss, um allein den Strombedarf dafür zu kompensieren! Hätten wir hier wirklich radikal in energetische Nachhaltigkeit investiert, wäre das eine andere Lösung geworden. Wir hätten auf lokale Bau- und Brennstoffe gesetzt und anders gebaut – und wären vielleicht besser bei Holz und Halm geblieben.
MW: Auch solche Technik hat ihre Tücken und schützt nicht vor Rebound-Effekten. Müssten wir unser Haus mit Holzpellets heizen, bräuchten wir dafür 20 Hektar Wald. Würde man nur die Haushalte der Schweiz mit 20 Hektar multiplizieren, käme ein Wald doppelt so groß wie Deutschland heraus.
JH: An allen Stellen rennen wir also gegen die Wand. Wie sollen wir da die begeisternde Geschichte über die Zukunft erfinden, die du so gerne erzählen möchtest?
MW: Das ist tatsächlich meine Frage an die Welt. – Ich will aber nun mal nicht von meiner Überzeugung lassen, dass alle gesund leben könnten, wenn wir wirklich sorgfältig mit den Ressourcen der Erde umgingen …
JH: Wie fühltest du dich, wenn du am Ende des Lebens erkennen müsstest: Alles, was du gesagt hast, war in den Wind gesprochen?
MW: Ich bin jetzt 53 Jahre alt und frage mich sehr oft: Ist meine Arbeit sinnvoll? Seit meiner Kindheit hatte ich ein positives Verhältnis zu einer nachhaltigen Zukunft. Als die Schweiz 1973 von der Ölkrise betroffen war, durften wir Kinder auf der Autobahn Fahrrad fahren. Das gab mir ein Gefühl, dass ich die Welt ganz anders sehen kann als die Erwachsenen, denen das ausgehende Öl Angst machte. Aus diesem Lebensgefühl heraus schmerzt es mich wenig, wenn Leute sagen: Wir müssten in mehr Wachstum investieren. In so einem Moment fühle ich mich nicht angegriffen, sondern habe eher Mitleid für deren Missverständnis.
Es ist für mich fast zu einem Spiel geworden, mich darüber zu wundern: Warum kann die Welt das Offensichtliche nicht sehen? Selbstverständlich bedrängt es mich auch oft emotional. Doch meistens lebe ich mit der Faszination eines Rätsels, das so offensichtlich vor uns liegt. Ich treffe in meiner Arbeit viele interessante Menschen, erlebe mich deshalb als privilegiert und bin sehr dankbar dafür, dass so viele Menschen unsere Institution unterstützen und sagen: Geh voran, gib Orientierung! Selbstverständlich würde ich gerne mehr zurückgeben, als ich kann – Orientierung geben im Sinn der Aussage: Es geht nicht nur um Selbstverzicht, sondern gestaltet euer Leben so, dass es funktioniert und inspiriert!
Vor 15 Jahren habe ich Einladungen zu meiner Hochzeit verschickt, und ganz viele Leute kamen zum Fest. Heute möchte ich gerne Einladungen zum guten Leben verschicken – aber irgendwie reagieren nur sehr wenige so freudig darauf wie auf die Hochzeitskarte …
JH: Das ist ein schöner, wenn auch bittersüßer Schlussgedanke. Können wir zum guten Leben einladen? So ein Leben nährt sich aus anderen Quellen als nur aus materiellen oder gar fossilen Ressourcen. Es gibt immer Menschen – wenn auch vielleicht zu wenige –, die auf diesem Ohr zuhören.
Mathis Wackernagel (53) entwickelte zusammen mit William Rees das Konzept des »ökologischen Fußabdrucks«. Er gründete 2003 das »Global Footprint Network« in Oakland, Kalifornien, das heute auch in Genf und Manila Standorte unterhält, und ist weltweit in Forschung und Lehre tätig.
www.footprintnetwork.org
Erschienen in Oya Ausgabe 36 (2016)