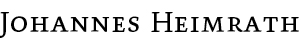Manche Beiträge in dieser Ausgabe von Oya brachten mich ins Sinnieren: Da ist einerseits das Vorurteil der Außenwelt, Gemeinschaften, das seien doch die mit der »freien Liebe«. Andererseits zeigen die Geschichten in diesem Heft, dass hier vieles durchlebt wurde, was zu ganz anderen, differenzierten Anschauungen geführt hat. Vor einigen Jahren, als bei ähnlicher Themenstellung immer wieder von »freier Liebe« die Rede war, musste ich an einen Halbsatz von Nietzsche denken, der mir bis heute als wahr erscheint. Nach wie vor frage ich mich, ob da nicht etwas Grundlegendes verwechselt werde. Ist Liebe – anders als der Eros – denn kein Absolutum, so absolut wie Freiheit? Ist Liebe auch nur im geringsten mit Zwang, und sei es auch der romantischste aller süßen Zwänge des Begehrens, in Verbindung zu bringen? Sollte etwas, das nicht frei ist, nicht anders genannt werden als Liebe? Statt »freie Liebe« ehrlicherweise »schweifender Eros«, »multiple gegenseitige Ichtröstung«? Es mag Rückständigkeit meinerseits sein, aber der Gedanke brummt in mir, dass da eine größere, dunklere Tiefe auf uns warten könnte als das warmwassrige Schnorchelparadies des schweifenden Eros, in dem sich das Plätschern als Geschäft betreiben lässt.
Hier der Satz: In seiner Vorrede von 1886 zu »Menschliches, Allzumenschliches« spricht Nietzsche von »jener r e i f e n Freiheit des Geistes, welche ebensosehr Selbstbeherrschung und Zucht des Herzens ist und die Wege zu vielen und entgegengesetzten Denkweisen erlaubt …« – Pause. – Dem werde erstmal gerecht! (Das r e i f e n hat Nietzsche selber hervorheben lassen.)
Ist das Nicht-Verfallen einer Lockung, das Nicht-Verwirklichen eines Bedürfnisses, das Lebendighalten einer Sehnsucht als Sehnsucht immer synonym mit Verklemmtheit? Beschneidet die Zucht des Herzens wirklich die Qualität einer komplex sozialisierten Westeuropäerin, eines Westeuropäers? Hmm.
Was ist das eigentlich, diese Suche nach Tiefe in allem, die mein persönliches Lebensspiel begleitet, seit ich meine ersten selbständigen – und eben als entgegengesetzte erfahrene – Denkwagnisse unternahm? Diese Suche nach Verbindlichkeit ohne Verklebtheit, dieses übende, loslassende Erforschen eines Ahnens, bis es zum Kennen wird? Ist es nicht so, dass erst die ablenkungslose (deswegen doch nicht unheitere) Vertiefung in etwas – ein Tun, eine Kunst, ein Lachen, in eine lautere Wahrnehmung der mehr-als-menschlichen Welt wie eines anderen Menschen – das gleich oder gegengleich schwingende Erleben, Erfahren und Wachsen einer lebenslang tragenden Beziehung hervorbringt? Ist das eine Selbstbespiegelung, die auf mich als Narziss zurückweist und am Ende in ein Alleinsein führt, das nicht geteilt werden kann? Oder ist es etwas vom Eigentlichen, das uns Menschen ausmacht – gar uns aufgegeben ist? Hinter und unter den Oberflächen all dessen, was wir uns genehmigen? Oder nur eine Ranke der Kultur, die sich um den simplen Fortpflanzungstrieb windet?
Eine Gesellschaft, die liebt, sieht, denke ich, anders aus als eine, die »freie Liebe« praktiziert. Ob tatsächlich ein Weg von letzterer zu ersterer führt, weiß ich nicht. – Jetzt kommt auch erstmal der Frühling …
Herzlich, Ihr Johannes Heimrath (Herausgeber)
Hier geht’s zu Oya Ausgabe 13