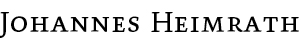»Es ist einfach schön, wenn man einen Chef hat!« Das antwortete eine tüchtige Sekretärin einst auf meine Frage, warum sie sich nicht zusammen mit den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer insolventen Firma, bei deren Umgestaltung ich half, selbständig machen wolle – selbstbestimmt, paritätisch, in einem Team, in dem ihre Stimme genauso viel zählen würde wie die aller anderen. Ich lernte: Es gibt Menschen, die es regelrecht genießen, statt unbeirrt den eigenen Weg zum Selbstausdruck zu verfolgen – dessen Versagung ich bei mir und anderen bis dahin stets als Leid erlebt hatte –, sich für die Verwirklichung eines anderen partiell aufzugeben. Ein Führer gibt ihnen Richtung und Ziel vor, und dann kann man seine ganze Leidenschaft und Fähigkeit einsetzen, den gesteckten Rahmen bestmöglich auszufüllen. Marei-Suela – nennen wir sie mal so – war warmherzig, kreativ, intelligent, stand ihre Frau in allen privaten Lebenslagen. Aber im Job für sich selbst verantwortlich zu sein, das wollte sie nicht – auch nicht um den Preis eines womöglich höheren Einkommens. Sicherheitsbedenken mögen eine Rolle gespielt haben, Angst vor Fehlern in Bereichen, die sie nicht beherrschte und die sie auf sich zukommen sah, vielleicht auch mangelndes Vertrauen in die soziale Kompetenz ihrer Kolleginnen und Kollegen. Im Kern machte ihre Aussage klar, dass der Job nicht das war, was sie als essenziell für ihr Leben fühlte. Dort wollte sie die Entscheidung anderen überlassen. Entscheidungsmacht war etwas, das sie dann draußen, im Privaten, selbstverständlich in Anspruch nahm. Freilich: Hätte es keinen Job für Miete, Essen und Urlaub gebraucht, würde ihre Kraft in Tätigkeiten geflossen sein, die sie als erfüllender empfunden hätte. Doch die Freiheit, ihren Lebenssinn anderweitig zu suchen, war ihr nicht gegeben. Damals war ich der Ansicht, sie ersetze den Mangel an Sinn in ihrer Bürotätigkeit durch die Befriedigung, für den Verzicht auf Verwirklichung des mit ihrem Leben Gemeinten Geld und kollegiale Anerkennung zu erhalten.
Seitdem denke ich immer wieder an Marei-Suela. Sie dient mir als stetiges Korrektiv, wenn mich die Begeisterung für eine Gesellschaft, in der freie Menschen, die sich frei darin unterstützen, das je mit ihnen Gemeinte – das unbedingt Gute, Schöne und Wahre also – zu entfalten und aus voller Herzenskraft gemeinsame Entscheidungen suchen, mit sich reißt. Ich erkenne dann: Das ist ein arroganter Anspruch, der der Lebenswirklichkeit wohl der allermeisten Menschen überhaupt nicht gerecht wird. Es hat mich Anstrengung gekostet, aber inzwischen weiß ich, dass man auch herzensgebildet, anteilnehmend, hörend und sich keineswegs selbst verleugnend einem anderen folgen und dienen kann.
Ist also führen und sich führen lassen immer »undemokratisch«? Ist Dienen immer mit Preisgabe der Selbstbestimmung verbunden? Oder steckt gerade im Dienst, im Dienenkönnen das Geheimnis für wahre Gemeinschaft? Es könnte doch sein, dass man nur dann wirklich dienen kann, wenn man die Kunst der Selbstbestimmung vollkommen auszuüben versteht, nicht wahr?
Mit den besten Spätsommergrüßen,
Ihr Johannes Heimrath (Herausgeber)
Hier geht’s zu Oya Ausgabe 22