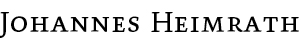»Sei du der Wandel, den du in der Welt erleben willst« – dieser Rat von Mahatma Gandhi wird oft zitiert. Doch häufig habe ich den Eindruck, die weisen Worte seien zu einem Mantra der Selbstbestätigung verblasst, das sich auch auf einem Zettel in einer Gebetsmühle befinden könnte. Beim Wort genommen, wüsste ich nicht, wie Gandhis Herausforderung anders zu verwirklichen wäre als durch ein außerordentlich intimes Verhältnis zu dem, was noch nicht ist, was noch an keinem Ort existiert – was einstweilen noch am »U-Topos« (am »Nicht-Ort«, von griechisch οὐ, »nicht«, und τόπος, »Heimat, Stätte, Stelle, Ort«) ausharrt, bis sich irgendein Mensch seiner erbarmen und es in die manifeste Welt hinübergeleiten möge. »Transire«, lateinisch, heißt »hinübergehen«, und so, wie ich das Wort »Utopie« verstehe, ist damit der Zustand einer Wirklichkeit gemeint, die den Prozess des Transits aus dem unendlichen Reich des Möglichen in die weltliche Eindeutigkeit noch nicht begonnen hat. Dabei unterscheide ich »Utopie« von einem häufigen, aus sprachlicher Nachlässigkeit herrührenden Missverständnis: Als »Illusion« (von lateinisch »illudere«, »jemandem falsche Hoffnungen machen«) empfinde ich das, was im Kontinent des Unmöglichen haust; von dem führt keine Brücke auf die Gestade des Manifesten herüber.
Mit Hilfe der Fantasie lässt sich auf dem Kontinent der Illusion vergnüglich spielen (lateinisch »ludere«, »spielen«). Dort gibt es nichts zu verantworten, und von Kandiszuckerbergen und Limonadenquellen oder von Perpetua mobilia und dem plötzlichen Verschwinden aller Kernkraftwerke zu träumen, hat in der Regel keinen unmittelbaren Einfluss auf die größere Geschichte.
Was jedoch einer Utopie dazu verhilft, sich aus dem Reich des Möglichen in die Wirklichkeit hinein zu verlebendigen, ist die Kraft der Vision. Wie alle menschlichen Talente lässt sich auch die Fähigkeit, die Kraft der Vision zu nutzen, trainieren und in ständiger Ausübung vervollkommnen. Im Reich des Möglichen wurzelt hohe Verantwortung: Was – im Wittgenstein’schen Sinn – der Fall wird, wenn es aus der Utopie ins Leben hinein entstirbt, wird Gegenstand, Praxis oder Gesetz, und damit unterliegt es allen Absichten, die manifeste Menschen haben können, guten wie schlechten. Was in der Vision »besser« als das Manifeste erscheint und sich zur Verwirklichung anbietet, impliziert daher die ethische Verpflichtung, sich die möglichen Schatten des möglichen »Besseren« bewusstzumachen. Ein visionäres Leben zu führen, heißt somit, sich stets darin zu üben, die Verwirklichung des Utopischen so unauffällig zu gestalten, dass niemand begehren möge, das manifest Gewordene für Zwecke zu missbrauchen, die sich gegen das »Bessere« oder gar »Gute« wenden. Kann diese Gefahr nicht vernünftig kleingehalten werden, sollte das Mögliche am »Nicht-Ort« bleiben dürfen, so lange, bis andere Verlebendigungen von Möglichem einen geeigneten Kontext geschaffen haben. Dazu bedarf es erheblicher Geduld. Diese aufzubringen, mag in Zeiten, in denen viele Menschen eine Katastrophe heraneilen fühlen, schwerfallen. Soll aber aus dem, was mit der Kraft der Vision geschöpft wird, nicht zusätzliches Unheil entspringen, ist es wohl mindestens so wichtig, die Fähigkeit zur Geduld zu trainieren, wie es die Übung der Kraft der Vision ist.
Das meint, wie immer herzlich,
Ihr Johannes Heimrath (Herausgeber)
Hier geht’s zu Oya Ausgabe 59