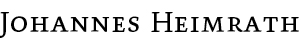Vor drei Jahren verbrachte ein guter Freund, Geologe von Profession, einen langen Tag mit mir und einigen Mitgliedern meiner Wahlfamilie auf einem Feld, das wir in den kommenden zehn, fünfzehn Jahren der Frage widmen, ob und wie sich eine Allmende-Gemeinschaft von bis zu hundert Personen ausschließlich von besagtem Stück Land versorgen könne. Es sind siebeneinhalb Hektar Ackerland, und um dort eine vielfältige Baumfeldwirtschaft zu etablieren, studierten wir die Verfügbarkeit von Wasser im Untergrund. Der Geländeschnitt, den unser Freund erbohrte, ergab reichlich H2O. Es quoll aus 1,20 Metern, aus 1,40 Metern, aus 2 Metern Tiefe ergiebig von den Schichten empor. Wasserführende Gräben und kleine Teiche erschienen vor den geistigen Augen der Planenden.
In diesem Jahr wollten wir nun diese Quellen zur Bewässerung unserer ersten Kulturen – Minze, Rotklee und Sonnenblumen – nutzen, um zu vermeiden, einen Brunnen bis zum Grundwasser in 25 Metern Tiefe bohren lassen zu müssen. Eine Grabung ergab jedoch – Sie ahnen es – nichts. Noch in 3 Metern Tiefe – kein einziges Tröpfchen Wassers, das sich aus den betonharten Schichten hervorgequetscht hätte. Drei trockene Sommer, und der Boden ist erledigt.
Dann kam der Regen – drei Wochen lang immer wieder in guter Menge, jeweils gut zehn und mehr Liter auf den Quadratmeter, nicht zu heftig, sondern stetig und durchdringend. Die Spatenprobe ergab: Die oberste Bodenschicht, kaum 20 Zentimeter stark, war feucht. Darunter: Staub und steinharter Lehm. Der Wind saugte das restliche Nass, das die Pflanzen noch nicht selbst verzehrt hatten, aus den Kapillaren, und heute staubt es schon wieder wie vordem. –
Sie meinen, ich hätte nur noch die Dürre im Sinn, weil ich schon mal darüber geschrieben habe, und es gäbe noch andere wichtige Dinge auf der Welt? – Ich fürchte, das könnte ein Irrtum sein. Wir Menschen sind gewiss in vielen Dingen anders als die übrigen Kinder Gaias. Doch Hunger und Durst teilen wir mit allem organischen Leben. Der standardisierte »Mensch« verdurstet nach vier, fünf Tagen. Manche Pflanze verdurstet in wenigen Stunden, manche hält mit minimaler Feuchtigkeit Monate, gar Jahre lang durch. Wo wachsen diese letzteren Pflanzen heute? Wie holen wir sie hierher? Wie hegen wir sie? Und wie gewöhnen wir unsere Geschmacksknospen und – viel wichtiger noch! – das Mikrobiom in unseren Eingeweiden an die neuen Nahrungsmittel – Nüsse, Kastanien, mehrjähriges Gemüse? Denn soviel ist klar: Jährlich anzubauendes Getreide, »heimische« Gehölze, wasserdurstige Obstsorten – das wird bald nichts mehr werden.
Vielleicht haben Sie recht, und alles kommt anders: Lange, milde Winter mit dicken Schneedecken auch im Flachland, im Rest des Jahres ständiger sanfter Regenfall, jede Nacht, und tagsüber viel Sonne, sommers Temperaturen um die 25 ° C. – Sollte es aber nicht so kommen, wird es nicht lustig werden. Einstweilen frage ich mich, wie wir dann den »freien Fall«, den jene sicherlich viel »Leid erzeugenden Wirklichkeiten« mit sich bringen werden, dem Titelthema dieser Oya-Ausgabe getreu »konstruktiv wenden« wollen. Der Zeitpunkt, an dem die Kräfte unserer gut gewarnten Gesellschaften ausgereicht hätten, die Zukunft zu verändern und uns eine gute Vergangenheit zu schaffen, dürfte verstrichen sein.
Wie immer grüßt Sie herzlich,
Ihr Johannes Heimrath (Herausgeber)
Her geht’s zu Oya Ausgabe 60