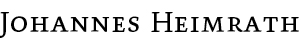ich sitze vor unserem baufälligen Schnitterhaus im Schatten eines weit ausgebreiteten Fliederbaums und sehe vor mir im Sonnenlicht eine verwilderte Edelrose. Zu zweien und zu dreien schwanken die üppigen Blüten auf ihren langen Stielen in der leichten Junibrise. Ihr Farbenspektrum reicht von tiefdunklem Karminviolett bis zum blendenden Zinnoberrot; das rote Licht scheint aus den samtigen Blütenblättern zu dringen, als wären sie das Leuchten an sich, kein Stoff, nicht Biologie, nur eine imaginäre Gestalt, in der sich das Licht ballt und von den harten Schatten, die die hohe Nachmittagssonne in das Formenlabyrinth der Rosenblüten tuscht, geradezu hervorgepresst wird – eine Protuberanz aus roter Energie. Nicht sehen, nicht hören, aber fühlen kann ich den schneidenden Sopran, in dem die roten Blüten das Jubellied ihrer Existenz trillern, laut und hoch, und ich muss lachen, weil mir die grellrot geschminkten Lippen im weißen Gesicht einer Opernsängerin einfallen, die ich mal als Turandot in Budapest gesehen und gehört habe.
Ein kräftiger Trieb der Rose hat sich auf den Weg nach oben gemacht. Er steigt ohne Halt die Wand empor, als könne ihn nichts ablenken, und dort, wo die Vertikale nicht länger verfolgt werden kann, weil die schroffe Grenze der Schalbretter des Dachs zur Umkehr zwingen, biegt sich der Trieb nach vorne, der Dachrinne zu, zwängt sich durch die Lücke zwischen Traufkante und Rinne, stützt sich, längs in der Rinne weiterwachsend, ab und schickt fünf, sechs mesotone Zweige weit über das Dach hinaus. An jedem dieser Zweige wippen noch mehr Blütenpakete über grüngoldenen Blättern, sechs, acht, neun rote Energiestrahler schwingen, kirrend im Ultraschall, vor dem taubenblauen Himmel. Kein königliches Wappen mit seinem Rot und Gold kann da mithalten, und die Kinder haben längst erkannt, dass das Haus eine Krone aufhat.
Wie blendet uns die Rose mit ihren Fortpflanzungsorganen, wie bannt sie uns mit dem Ledergrün ihrer Kraftwerke, den sonnengierigen Blättern, wie lässt sie uns staunen über die Kraft, die sie in wenigen Wochen entwickelt, um meterweit in die Breite und Höhe zu streben! Dabei sind das nur Anhängsel, über die Erde ausgestülpte Tentakel, in denen sich Photonen, der Wind und Insekten verfangen, exakt auf die Eigenarten von Photonen, Wind und Insekten getrimmte Fallen, um das eigene Überleben und das Weiterleben ihrer Art zu sichern – nicht ganz ohne Lohn freilich: Sie tauscht ihr Sein gegen Atemluft für die Sauerstoffatmer, Wasserdampf für die Regendurstigen, Blütenstaub und Zuckerwasser für die Rüsselflieger. Die eigentliche »Pflanze«, ihr Zentrum, in dem wir das Ich der Rose vermuten dürfen, versteckt sich im Boden. Wie handelt sie dort mit ihren Wurzelarmen und Wurzelhänden das Leben aus, eifrig, in ständigem Gewisper mit Würmern, Asseln, Pilzen, Bakterien! Gott, würde ich so schlaflos leben können, so irrsinnig beschäftigt mit ständigem Hin und Her von Molekülen, ständigem Neubilden von Gliedern, Organen, so ständig da, präsent, wachsend, leuchtend, singend? – Die Zellen meines Körpers tun’s.
Mit guten Wünschen für warme Sommertage,
Ihr Johannes Heimrath (Herausgeber)
Hier geht’s zu Oya Ausgabe 39