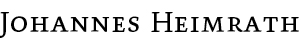Johannes Heimrath und Lara Mallien sprachen mit Antje Tönnis über ihre Arbeit in der GLS Treuhand, die sich für eine »Schenkungskultur« engagiert.
Inzwischen ist die GLS Bank, die »Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken«, weit bekannt. Weniger im Rampenlicht steht der Verein GLS Treuhand e.V., der zwischen gemeinnützigen Organisationen und Stifterinnen und Stiftern vermittelt. Seit wann gibt es die Treuhand?
Die GLS Treuhand, die früher gemeinnützige Treuhandstelle hieß, wurde 1961 gegründet. Die Gemeinschaftsbank ging erst später, in den 70er Jahren, daraus hervor. Engagierte Eltern, Lehrerinnen und Lehrer hatten bei der Gründung einer Waldorfschule in Bochum viel Erfahrung in der Finanzierung und im Aufbau gemeinnütziger Projekte gesammelt. Es wurde Land gekauft und viel ehrenamtliche Arbeit eingesetzt. Einzelne Menschen aus dem Umkreis dieser Initiative waren vermögend, und man wollte die erworbenen Finanzierungs- und Netzwerk-Fähigkeiten gerne weitergeben. So kam der Gedanke auf, über das Schulprojekt hinaus eine Struktur zu schaffen, die Schenkungen und Stiftungen vermittelt. Gleichzeitig gab es um Wilhelm Ernst Barkhoff – ein anthroposophischer Rechtsanwalt – viele Menschen, die einen anderen Umgang mit Geld vorantreiben wollten. Dazu gehörten auch Unternehmer, die Firmengewinne in gemeinnützige Arbeit fließen lassen wollten. Deshalb sollte eine Treuhandstelle gegründet werden, die nicht nur Finanzinstrumente entwickelt, sondern auch die Zusammenarbeit untereinander fördert. So kam es schließlich zur Vereinsgründung. Anfang der 1970er Jahre machte die Bankenaufsicht deutlich, dass man für Teile der Treuhandarbeit eine Bank brauchte, und so entstand der Vorläufer der GLS Gemeinschaftsbank. Zur Grundlage der Treuhand-Arbeit wurde Rudolf Steiners Begriff vom Schenk-Geld, das neben dem Kauf- und dem Leih-Geld den Bereich des freien Geisteslebens, also Bildung und Kultur, finanzieren soll und bei ihm als wichtiger Bestandteil der Ökonomie gilt. Dieser Ansatz ist immer noch zentral, aber wir beschäftigen uns inzwischen auch mit zeitgenössischen Theorien zur Gabe oder der matriarchalen Schenkökonomie.
Was war deine ursprüngliche philosophisch-spirituell-politische Prägung?
Nach dem protestantischen Elternhaus war das in den 1980er Jahren eher die politisch autonome, antiimperialistische und auch die spirituelle Frauenbewegung. Ich liebe es, Grenzgängerin zu sein, und ich integriere gerne. Deshalb habe ich mich nie nur einer bestimmten Szene zugehörig gefühlt.
Warum fasziniert dich der Akt des Schenkens, des Gebens?
Wir sprechen in der Treuhand viel über die Spiritualität und die Psychologie des Schenkens. Dabei wird es sehr schnell sehr persönlich. Wenn sich ein Mensch ganz oder zum Teil von seinem Vermögen trennt, ist das ein radikaler Schritt. Dabei stellen sich Fragen wie: Wie möchte ich das Allgemeinwohl unterstützen, wie soll die Welt meiner Überzeugung nach aussehen, und wie trage ich dazu bei? Die wenigsten Leute geben einfach so etwas her. Das Schenken ist wie ein kleiner Tod. Da stirbt etwas Altes, man trennt sich, etwas Neues wird geboren. Man darf keine Angst haben. In einer angstbasierten Gesellschaft ist es schwierig und immer ein Lernakt, frei zu geben.
In einer Gesprächsrunde erlebten wir kürzlich, wie jemand den Microsoft-Gründer Bill Gates als sozialen Unternehmer rühmte, weil er mit seinen Milliarden gemeinnützig tätig ist. Er schenkt zwar durchaus – und das ist immerhin löblich –, aber bringt das schon ein »anderes Wirtschaften« mit sich?
Über diesen Aspekt diskutieren wir in der Treuhand viel: Woher kommt das Geld, und wer bestimmt, wohin es geht? Auch eine Stiftung ist ja keine demokratische Einrichtung. Wir versuchen einerseits, die Verbindung zu unserem Projekte-Netzwerk zu halten, und fragen: Wo finden gesellschaftliche Entwicklungen statt, die wir unterstützen wollen, wo sind die Bereiche, in denen neue Kulturimpulse entstehen, die sich aber mangels Geld nicht genug entwickeln können? Und andererseits fragen wir: Wirtschaften auch die Zustifter im Sinn einer lebensfördernden Kultur? Mit fällt der Wachsmalkreiden-Hersteller Stockmar ein. Das Unternehmen ist Teil der Neuguss-Holding; deren Firmen werden einerseits nach kapitalistisch-wirtschaftlichen Kriterien geführt. Andererseits achtet man dabei aber auf eine faire Verteilung der Mittel. Die Betriebsführung legt Wert auf gesunde Arbeitsplätze, und die Kreativität der Arbeiterinnen und Arbeiter wird vorbildlich gefördert. Das ist wohl weit entfernt von Microsoft, trotzdem bleibt es ein hierarchisch organisierter Industriebetrieb, es gibt keine kollektive Struktur.
Wenn wir die Frage nach der Produktivität einer auch noch so ideal organisierten Fabrik stellen, landen wir irgendwann bei den Rohstoffen, die sie verarbeitet, und dann bei einem Minenarbeiter, der meist in einem südlichen oder östlichen Land zu mehr oder weniger menschenunwürdigen Bedingungen schuftet. Das bereitet Unbehagen.
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu uns kommen, haben ein hohes Bewusstsein für diese Problematik. Ein radikales Beispiel ist die Firma Sonett, der Öko-Waschmittelhersteller. Die Geschäftsführer erzählten neulich auf einer Veranstaltung, dass die Firma einen Teil ihres Gewinns besonders denjenigen Bereichen schenkt, die mit ihrer Produktion zu tun haben. Dort fragen sich die Menschen auch, wer über die Verwendung des Gewinns eigentlich mitbestimmen müsste – und wer den Gewinn miterwirtschaftet. Gehören auch die Leute dazu, die in der Transportfirma arbeiten, und diejenigen, die die Produkte verkaufen, auch die Zulieferer, die Endverbraucher und die Urproduzenten?
Die Schwierigkeit bei solchen Bemühungen ist die Struktur, die unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem trägt. Sie ist auf den Erhalt des Bestehenden ausgelegt – alles soll am besten noch rationeller, noch technikintensiver, noch massenproduzierter gestaltet werden. Um anders wirtschaften und arbeiten zu können, brauchen wir eine andere Gesellschaftsstruktur. Ich erlebe das Schenken oft als eine Übung, sich dafür ganz neu auszurichten.
Was würdest du im Sinn dieser Neuausrichtung selbst gerne unternehmen?
Ich würde mich gerne noch mehr damit beschäftigen, wie man umfassender anders leben kann und wie ich die Schnittstellen zwischen denen, die jetzt ein anderes Leben entwickeln, und denen, die politisch an Änderung arbeiten, besser verbinde. In vielen der von uns unterstützten Projekte passiert so viel gesellschaftlich Relevantes, das in der Öffentlichkeit kaum sichtbar wird.
Ich denke derzeit viel über die Trennung zwischen Privatleben einerseits und Wirtschaft und Arbeit andererseits nach, das ist auch für den Zusammenhang der Treuhand-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter ein Thema. Was hat meine Arbeit mit meinem Leben zu tun, wie lebe ich selbst, was soll anders werden? Wie können wir neue Arbeits- und Lebensperspektiven entwickeln? Kürzlich haben wir mit einem kleinen Team von der Treuhand einen ökologisch wirtschaftenden Bauernhof besucht. Dort wird so viel harte Arbeit geleistet, die in unserer Gesellschaft gering honoriert wird. Darüber haben wir gemeinsam reflektiert, über die Werte, für die sich jeder Einsatz lohnt. Wir haben dort auch die Frage nach der Altersversorgung der Menschen, die auf dem Hof arbeiten, gestellt. Darauf haben wir nur schallendes Gelächter geerntet – Alterssicherheit? Gibt es dort nicht. Woher soll das Geld auch kommen? Da existieren Parallelwelten, die unterversorgt sind, und keiner merkt etwas davon.
Beim Gedanken an Altersvorsorge sehen wir in der Zukunft neue soziale Strukturen, weil die staatlichen Hilfen nicht mehr tragen. Traditionelle Formen des Zusammenlebens der Generationen werden wiederentdeckt. Deren überkommene Schattenseiten sind jedoch Enge und mangelnde Freiheit …
Hier wird für mich die Gemeingüter-Debatte relevant. Wie lassen sich gemeinschaftliche Strukturen selbstbestimmt organisieren, ohne dass Freiheit beschnitten wird? Viele Menschen in der Generation meiner Eltern haben jetzt eine ganz gute Rente, ihnen hat der Sozialstaat viel Freiheit beschert. Aber diese Freiheit wurde durch eine Wirtschaft auf Kosten der Verlierer der Globalisierung erreicht. Vielleicht lassen sich in Zukunft überschaubare Strukturen schaffen, in denen 300 oder auch 3000 Menschen wirtschaften und in arbeitsteilig organisierten, gemeinschaftlichen Zusammenhängen füreinander sorgen, ohne dass es zu Monokultur und der Schattenseite der moralischen Familienverpflichtungen führt.
Diversität statt Monokultur ist freilich ein Zauberwort. Nur Systeme mit hoher Biodiversität sind überlebensfähig. Angesichts einer krisenbedrohten Zukunft stellt sich die Frage, ob Geld für unsere sozialen Aufgaben überhaupt noch zur Verfügung steht. Uns scheint, dass soziales Schenken in den Vordergrund treten wird.
Ja, und das ist etwas anderes, als Schokolade zu verschenken. Die Menschen in gemeinnützigen Organisationen, denen wir von der Treuhand Geld vermitteln, arbeiten in der Regel aus freien Stücken doppelt so hart wie in einem normalen Betrieb. Ich komme oft aus dem Staunen nicht heraus, mit wie wenig Geld in kleinen Projekten unglaublich viel aufgebaut und an die Gesellschaft geschenkt wird.
Ja. Dadurch entsteht Volksvermögen, das kaum gewürdigt wird. Man müsste einen Weg finden, solche Schenkleistung in einer Art alternativer Bilanz zu veröffentlichen, sie auf irgendeine Weise zu dokumentieren.
Das ist eine schöne Idee – sich bewusstzumachen, welcher Reichtum dabei geschaffen wird. Das erinnert mich auch an die Diskussionen über die unbezahlte Arbeit der Frauen. Bei so einer Schenk-Bilanz müsste man aus der Logik des Zählens und Vergleichens aussteigen. Ich kann vielleicht Zeit messen, die ich für etwas eingesetzt habe, aber die Intensität, die Lebensfreude oder die Schwierigkeiten, die in diesen Stunden stecken, lassen sich nicht messen. Ich nehme diese Idee mit, vielleicht können wir in der Treuhand über so eine Darstellungsmethode weiter nachdenken.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Dr. phil. Antje Tönnis (47) ist Geografin (Forschungsschwerpunkte Waldpolitik und Frauenforschung) und langjährige Politikmanagerin; seit 2007 gestaltet sie die Kommunikation in der GLS Treuhand.
Erschienen in Oya Ausgabe 3 (2010)