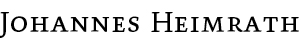»Tempel der Ahnen« ist ein faszinierender Bildband des Fotografen Johannes Groht über die Megalithbauten in Norddeutschland, den Johannes Heimrath und Lara Mallien im AT Verlag herausgegeben haben. Das Buch enthält das folgende Gespräch zwischen Johannes Groht und Johannes Heimrath.
JOHANNES HEIMRATH: Herr Groht, heute Nachmittag haben wir den Steinkreis von Netzeband besucht. Ich habe mich beim Betreten des Ortes gefragt, wie Sie sich diesem Platz nähern. Wir wollten ja nicht lange bleiben. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wo der Steinkreis liegt, damit Sie ihn finden, wenn Sie morgen früh das erste Licht der aufgehenden Sonne zum Fotografieren nutzen wollen. Dennoch lässt man sich auf die Atmosphäre des Ortes ein, besonders, wenn man noch nie dort gewesen ist. Wie gehen Sie an solche Orte heran?
JOHANNES GROHT: Tastend, ein bisschen wie ein Blinder. Ich nähere mich einem Platz langsam und behutsam, versuche, die Atmosphäre aufzunehmen und zugleich eine Struktur zu erkennen. Mit »Struktur« meine ich zuerst nur ein paar Orientierungspunkte. Wie viele Steine sind da? Wo liegen die Himmelsrichtungen, in welcher Richtung erstreckt sich die Lichtung, auf welcher Seite ist der Wald? Ich gehe ein wenig umher und versuche, ein Gefühl für den Platz zu bekommen.
Auf welcher Ebene schalten Sie das Gefühl ein? Gibt es da so etwas wie eine Referenzgröße, eine Art »Referenzgefühl«?
Nein, das gibt es nicht – nicht im Sinn von Messbarkeit. Natürlich gibt es Erfahrungen, mit denen ich den Ort vergleiche. Ich lasse zunächst alles auf mich wirken. Das Gefühl ist von so vielen Faktoren abhängig: von meiner Tagesform, ob mir warm oder kalt ist, wer in meiner Gesellschaft ist – all das spielt eine Rolle dabei, ob ich mich überhaupt öffnen kann.
Ich stelle mir vor, dass Sie als Fotograf den Zugang primär über das Sehen finden. Oder spielt auch das Körpergefühl eine Rolle? Gibt es womöglich einen synästhetischen Zugang?
Es kommt sehr darauf an, ob ich nur neugierig auf den Platz bin oder auch fotografieren möchte. Der optische Eindruck ist selbstverständlich wichtig, aber die Qualität eines Ortes spüre ich eher körperlich beziehungsweise auf einer anderen Ebene, die man vielleicht ätherisch nennen könnte und die irgendwo zwischen Körper und Bewusstsein sitzt.
Heute Nachmittag im Steinkreis von Netzeband hatte ich ein Gefühl von Wärme, die sich ausbreitet. Es war sehr freundlich dort, leicht, fast wurde ich ein bisschen euphorisch.
Manchmal habe ich in Steinkreisen den Eindruck von einer Wirbelbewegung. Ich bekomme dann Lust, dem zu folgen und im Kreis zu laufen. Es ist gut, diesem Impuls nachzugeben. In den Steinkreisen von Stanton Drew in Südengland ist es mir so ergangen, auch in Boitin hatte ich das Gefühl, in dem großen Kreis müsse man eigentlich tanzen, stampfen und springen.
Stellen sich manchmal auch Gedanken ein, die erstaunlich sind oder fremdartig – Erinnerungen vielleicht?
Es sind eher Empfindungen, die mich fragen lassen: Was passt in diesen Steinkreis, was strahlt er aus, was würde man dort tun, was hat man früher dort vielleicht getan? Der Ort erzeugt in mir Resonanzen, die zu entsprechenden Assoziationen führen.
Viele der Orte, die Sie fotografiert haben, sind nicht leicht zu finden, und Sie haben von manchem Abenteuer bei der Suche erzählt. Ich denke, Sie führen, wie wohl die meisten Menschen, bei solchen einsamen Suchgängen auch Selbstgespräche mit Ihrem Selbstbild. Wie kommen Sie sich bei diesen Erkundungsfahrten vor? Für uns Menschen des 21. Jahrhunderts ist es doch ziemlich irrational, nach steinzeitlichen Trümmern zu suchen. Werden Sie jünger dabei? Gibt es vielleicht einen Helden aus Ihrer Kinderzeit, der mit von der Partie ist?
Nein, einen Helden sehe ich nicht, obwohl es manchmal schon heldenhaft ist, sich einen Weg durch all die Hindernisse zu bahnen. Aber intensive Gespräche mit mir selbst, die führe ich schon – mit einem Teil von mir selbst, der im Alltag eher zu kurz kommt. Und es ist auch ein gewisser Trotz dabei – vielleicht ist das etwas Jugendliches? Dieser Trotz will sich dem zuwenden, was andere vergessen und links liegen gelassen haben.
Im Unterschied zu anderen Ländern wie beispielsweise England oder Polen sind die vorgeschichtlichen Heiligtümer in Deutschland der vollständigen Profanierung und einer kaum zu verstehenden Missachtung anheimgefallen. Sie liegen im dichten Wald, werden in Äckern isoliert, dienen an Straßen als Picknickplätze. Richtet sich der Trotz auch dagegen?
Ja, das spielt eine wichtige Rolle. Es ist freilich schön, wenn man, wie mein berühmter Kollege Paul Caponigro, mit Fördergeldern zu den eindrucksvollsten und berühmtesten Plätzen Europas fahren und dort arbeiten kann. Aber das war nun einmal nicht mein Weg. Ich wollte sehen, was es bei uns noch gibt. Mir geht es sozusagen um das Hünengrab um die Ecke, und als Fotograf habe ich auch den Ehrgeiz, von unscheinbaren Plätzen starke Bilder zu machen. Ich nehme mir Zeit, um etwas zutage zu fördern, das diese Orte nicht auf den ersten Blick preisgeben. – Ich weiß nun nicht, ob Trotz das richtige Wort dafür ist.
Es kommt mir schon brauchbar vor, schließlich stemmt sich Ihr Impuls gegen einen Verfall, gegen eine Achtlosigkeit und ein allgemeines Vergessen von Anbindung – zumindest kultureller Anbindung. Diesen Erscheinungen setzen Sie etwas entgegen.
Die archaischen Steine sind in unserer Glas-Beton-Zeit im Grunde fremdartige Objekte, sie stammen aus einer längst verhallten Epoche, aber sie sind auch unmittelbar mit uns verknüpft – historisch, kulturell, rituell, energetisch. Durch die Kamera geschaut, scheinen sie zunächst nur Objekte zu sein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie objekthaft fotografiert sind. Wie sind Sie verbunden mit diesen scheinbaren Objekten?
Mir geht es ja um die frühen Spuren des menschlichen Geists in der Landschaft, und die Kraft dieser alten, von Menschen geschaffenen Plätze ist eine andere als die reiner Naturobjekte.
Oft habe ich das Gefühl, dass diese Orte ein Konzentrat der Landschaft sind. Die Grabhügel sind oft sehr weit in der Landschaft sichtbar und fokussieren die Aufmerksamkeit. Dazu kommt verstärkend, dass Menschen dort etwas getan haben, das den Orten einen Zentrums-Charakter verliehen hat. Die Ruinen regen mich an, über Grundfragen unserer Existenz nachzudenken. Sie wecken in mir eine Idee von der Bedeutung der Ahnen und der Heiligkeit der Menschheit als Ganzer, die zu bewahren und zu entwickeln unsere Aufgabe ist.
Die megalithischen Bauwerke waren keine personalisierten Grabstätten in der Art heroisierender Mausoleen, sondern soziale Brennpunkte, bedeutende Zentren für das gemeinschaftliche Leben der Clans und Großfamilien. Diese Ahnentempel waren für Gruppen von Menschen gedacht. Sie wurden über enorme Zeiträume hinweg als Orte der Kommunikation mit den Ahnen geachtet, an ihnen wurde in einer für uns kaum vorstellbaren Kette von sakralen Festen mit allem gefeiert, was die Menschen hatten. Ganze Rinderherden wurden dargebracht und verzehrt. Das Beispiel Gayhurst in Buckinghamshire belegt das eindrucksvoll.
Am Morgen nach einem großen Fest gehe ich manchmal in den Raum, in dem gefeiert worden ist, und fotografiere die Reste. Das sind faszinierende Spuren: umgestürzte Gläser, ein Blumenstrauß, halb leergegessene Schüsseln, der Müll, Spuren eines Kultereignisses – sehr ursprünglich. Die steinernen Spuren, die ein paar Jahrtausende alt sind, sind ja nicht wesentlich anders, es sind Hinterlassenschaften von feiernden Menschen …
Klar, das alles findet man dort auch. Es gibt allerdings derzeit einen Trend, auch unter Archäologen, diese Orte auf eine banale Alltäglichkeit zu reduzieren, und das ist wohl nicht gemeint. Ich denke, es waren vor allem sakrale Orte, und gerade dieser Hintergrund ist so spannend.
Die Menschen suchten anscheinend auch damals nach ihrem Ursprung. Wenn man ein Stück Wegs zurückblicken kann, fühlt man sich in die Kontinuität des Seins eingebunden und erfährt sich in einer Position, die im Verhältnis zu Raum und Zeit klar definiert ist. Das gibt uns Halt. Es ist sehr anregend, das wieder zu aktivieren. Dadurch weiß man freilich nicht viel mehr; die Erkenntnis ist auf eine relativ kurze Zeitspanne begrenzt – aber immerhin. Mehr als dieses kleine Raum-Zeit-System können wir kaum überschauen, und weiter als das sind wir trotz aller Wissenschaft nie gekommen.
Mir gefällt Ihre Aussage, die megalithischen Kultorte wirkten wie ein Konzentrat der Landschaft auf Sie. Ich kenne das Gefühl, zumal wenn sich topografische Bezüge ergeben, die der Kulturlandschaft fast eine Art schützendes Netz aus unsichtbaren Verbindungen zwischen den alten Heiligtümern überwerfen. Wäre das auch so, wenn wir nicht Steine als Zeugnisse jenes Kulturschaffens vor uns hätten, sondern Reste von Holzbauten oder nur Erdhügel?
Ich meine ja. Damals waren ja die Dolmen auch nicht sichtbar, sondern unter Hügeln verborgen. Ich habe auch immer wieder die Assoziation, diese Hügel seien Schnittpunkte verschiedener Achsen im Raum – und in der Zeit.
Die Steine sind noch eine weitere Verdichtung all dessen. Sie werden aus der umliegenden Landschaft geholt und zu einem architektonischen Gebilde verarbeitet. Insofern bilden sie tatsächlich ein Konzentrat der Landschaft.
Es muss viel Freude gemacht haben, solche Orte zu schaffen. Der erste Mensch, der einen Stein aufstellt, der vorher gelegen hat – das beeindruckt mich sehr, das ist ein enorm kreativer Akt. Das ist der Punkt, an dem der Mensch beginnt, selbst Schöpfer zu werden. In die horizontale Welt, die ihn umgibt, setzt er seinen Stein und sagt: Hier! Hier stehe ich, und hier steht dieser Stein! Das verändert ihn, und das verändert die ganze Welt.
Etwas davon spürt man noch an diesen Orten: eine große Kraft und einen starken Willen der Menschen, die jene Bauwerke errichtet haben.
Das Aufstellen des Steins – darin erkenne ich auch ein Symbol für die Idee der Dauerhaftigkeit der Persönlichkeit: Ich Mensch werde vergehen, aber mein steinerner Körper, zu dem ich den Menhir gemacht habe, wird von mir und meiner Existenz zeugen. Es könnte sein, dass die Steine als Seelenanker gedient haben, an denen das sich in jenen Epochen erstmals zeigende Ich-Bewusstsein den Halt fand, den das alte magische Bewusstsein nicht länger geben konnte. Vielleicht durften die Steine deswegen auch nicht bearbeitet werden – damit sie ihre Ur-Kraft nicht verloren, damit sie nicht zu menschenähnlich wurden.
Wie man weiß, beherrschten die megalithischen Baumeister perfekte Techniken der Steinbearbeitung. Neolithische Steinäxte zeigen, dass man nichts dem Zufall überließ und den Flint einerseits sehr ökonomisch, andererseits absolut perfekt bearbeiten konnte. Es war sicherlich eine bewusste Entscheidung der prähistorischen Menschen, den Stein so roh zu lassen, wie er war. Das klingt übrigens auch in der Bibel an. Bei Moses heißt es einmal, man solle einen Altar nicht aus behauenen Steinen machen, das würde ihn entweihen. Die existenzielle Kraft der naturbelassenen Steine wird durch die Megalithbauten überhöht und regelrecht zelebriert. Das macht diese Orte so besonders stark, denke ich.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie selbst auch etwas an den Platz aussenden?
Ich glaube ja. Manchmal scheint es eine Interaktion mit dem Ort zu geben, sei es eine Art Zwiesprache, sei es, dass ich einem Impuls zu einer Bewegung folge. Das verändert die Atmosphäre des Platzes.
Ist das ein persönliches Ritual?
Nein. Das ist ganz spontan, und es ist jedes Mal anders. Manchmal denke ich aber, dass das Hantieren mit der Kamera eine Art Ritual ist, um mich zu konzentrieren. Das hat sich auch verändert in den vier Jahren, die ich an dieser Serie gearbeitet habe. Inzwischen gehe ich oft sofort auf die Suche nach einem Bild, das ich machen möchte – oder soll …?
Dieses »Sollen« wäre ja eine Antwort auf einen Ruf. Gibt es so etwas in Ihnen, einen Ruf, so dass Sie plötzlich sehen: Dieses Bild soll es werden?
Manchmal ja. Manchmal gibt es eine leise Ahnung, dass irgendwo ein Bild wartet. Manchmal schreit es mich aber auch geradezu an. Bei den Rauhreif-Bildern aus Bunsoh war es zum Beispiel so. Das war wie ein Geschenk, das mir zu Füßen gelegt wurde. Ich sah sofort die Bilder und musste sie »nur« noch machen. Im Steintanz von Boitin hatte ich tatsächlich einmal das Gefühl, als würde er »sagen«: Mach Fotos von mir und veröffentliche sie! Es fühlte sich an, als ob das für den Ort etwas Wohltuendes sei.
Ich habe darüber nachgedacht, was Ihrem Buch, dem ich sozusagen ins Leben verhelfe, seine Legitimation gibt, was seine Botschaft sein wird. Bei vielen Ihrer Bilder spüre ich eine darüberliegende Schicht, die ich – wenn ich die Perspektive des Genius loci einnehme – so interpretieren könnte, als äußere darin der Ort den Wunsch, in das Leben der Menschen besser integriert zu werden. Vielleicht ist es nur eine eitle Projektion. Aber wenn Sie davon sprechen, dass ein Ort Ihnen sagt, »mach Fotos und veröffentliche sie«, dann scheint eine gewisse Legitimation in der »sprechenden« Qualität der Orte selbst begründet zu sein. Es liegt aber auch eine Zurückhaltung in jener Schicht, die wir wohl beachten müssen.
Die Veröffentlichung solcher oft sehr stiller und geheimnisvoller Orte hat etwas Zwiespältiges an sich. Wenn man etwas entdeckt oder wieder ausgräbt, sei es ein Monument oder ein indigener Stamm im Regenwald, unterliegt man der Gefahr, damit mehr kaputtzumachen als Gutes zu bewirken. Es ist mein Wunsch, dass die Leute achtsam und verantwortungsbewusst mit den Plätzen umgehen und sie nicht nur für ihre eigenen Zwecke benutzen.
In Ihren Bildern nehme ich die Aspekte von Behutsamkeit und Achtsamkeit besonders deutlich wahr. Sie gehen achtsam an einen Ort heran, und diese Information prägt sich den Bildern auf. Wir publizieren die Bilder auch nicht aus bloßer Eitelkeit.
Es ist auch eine fragende Haltung. Es geht mir nicht darum, etwas Altes wiederzubeleben, sondern einen wichtigen Teil unserer Geschichte, eine tiefere Schicht unseres Bewusstseins, aufzuspüren und zu integrieren. Und die Art und Weise, wie die Bilder entstanden sind, ist sicherlich ein Teil davon.
Ich habe den starken Wunsch, das Buch möge dazu beitragen, das Bewusstsein der Heutigen für das, was vergangen ist, zu schärfen. Sich das enorme Alter der Plätze zu vergegenwärtigen ist sehr bewegend. Wenn ich neue Bauwerke betrachte, denke ich oft: Steht das in ein paar Tausend Jahren noch? Und wenn, würde es noch überzeugen? Dabei frage ich mich auch, welche Rolle das Alter einer Sache spielt. Wie wichtig ist es, dass die Dinge alt sind?
Das Alter spielt wohl eine Rolle. Heute sind die Orte so schön pittoresk mit Moos bewachsen und von alten Bäumen umstanden … Wenn ich mir vorstelle, ich sähe die Orte vor 4000 oder 5000 Jahren – waren sie damals auch schon so stark? Heute spielt diese Ruinen-Romantik in unsere Wahrnehmung hinein. Die »magischen« Orte sind natürlich auch eine wunderbare Projektionsfläche für jedermanns innere Zauberwelten. Die tollsten Sachen lassen sich darin vermuten. Wie aber hätte zum Beispiel Boitin als »Neubau« auf mich gewirkt?
Diese Frage stelle ich mir oft auf unseren Reisen zu frühgeschichtlichen Heiligtümern, beispielsweise auf der Wallanlage von Old Sarum in Südengland: Wie müssen die frisch aufgeschütteten Wälle aus dem weißen Kreide-Gestein in der Sonne geglänzt haben! Wonach hat es geduftet – oder gerochen? Mit welchen Gefühlen haben die Menschen ihr gigantisches Bauwerk betrachtet? Sie haben die modernste Technologie ihrer Zeit eingesetzt – waren die frühen »Architekten« genauso stolz auf ihr Weltwunder wie unsere Hochhausmaniker?
Dann denke ich an die modernen Steinsetzungen, die heute im Zusammenhang mit geomantischen Maßnahmen, aber auch aus rein ästhetischem Bedürfnis in die Landschaft gepflanzt werden. Man fährt beispielsweise auf einer Schnellstraße in Österreich ins Waldviertel und sieht einen Steinkreis neben der Straße – Kunst am Bau? Warum berührt mich das nicht annähernd so stark wie ein alter Dolmen? Es sind doch auch Megalithen?
Ich habe noch keinen solchen Steinkreis gesehen. Vor einigen Jahren hat mich ein Foto eines von Marko Pogaˇcnik gestalteten Steins mit einem Kosmogramm sehr stark berührt. Aber ähnliche Arbeiten, die mir kürzlich über den Weg liefen, fand ich eher kitschig. Ich finde es auch problematisch, dass so eine Art Schule daraus geworden ist und immer mehr Leute die Kunst Pogaˇcniks nachahmen. Das hat wenig Kraft. Die Werke von Künstlern wie Richard Long, die in und mit der Natur arbeiten, sind meist viel stärker.
In Ihren Aufnahmen erkenne ich keinen »modernen« Kontext. Die Bilder befriedigen nicht die Sucht des zeitgenössisch verbildeten Auges nach der Ultrabrillanz der digitalen Farben, nicht die Sucht nach der rasiermesserscharfen Abbildung glänzender ästhetischer Objekte. Ihre Aufnahmen wirken weicher, stiller, wärmer, eher wie Gemälde oder wie Aufnahmen aus der Pionierzeit der Fotografie. Was für ein Geheimnis steckt hinter Ihrer Aufnahmetechnik?
Mich hat die von Ihnen beschriebene Art der Fotografie nie sonderlich interessiert. Fotografie ist für mich ein Mittel, mich mit der Welt und dem Leben auseinander zu setzen, einen Standpunkt zu finden. Deshalb habe ich als Fotograf auch meist freie Projekte verfolgt; ich wollte mir nicht von irgendjemandem hineinreden lassen.
Ich arbeite mit einer Großformatkamera und belichte Diapositive im Format 4 × 5 Zoll. Das ist ein rein manuelles Arbeiten, bei dem mir keine Automatik ins Handwerk pfuscht. Einerseits ist die Technik sehr einfach, andererseits kann man mit so einer Kamera wirklich alle fotografischen Mittel ausschöpfen.
Die Kamera besteht nur aus Objektiv, manueller Blende, Verschluss und Mattscheibe?
Sozusagen. Und sowohl die Objektiv- als auch die Filmebene lassen sich in jede Richtung verschwenken, was mir erlaubt, scheinbare Verzerrungen zu eliminieren und die Lage der Schärfenebene im Raum frei zu bestimmen. Das ist mit den meisten anderen Kameras nicht möglich. Dadurch kann man sehr ruhige Bildwirkungen erzielen.
Das Bild erscheint auf einer Mattscheibe an der Kamerarückseite, und zwar auf dem Kopf stehend, was auch schön ist. Es erinnert immer wieder an das Prinzip der Camera obscura.
Meine ersten Touren zu den Megalithplätzen waren wirklich Knochenarbeit, weil ich mit meiner Plaubel, einer alten Studiokamera, losgezogen bin. Die Ausrüstung wog 21 Kilogramm – deswegen musste ich mir auch wieder ein Auto kaufen, nachdem ich lange Zeit keines mehr gehabt hatte. Inzwischen bin ich für dieses Projekt 25000 Kilometer gefahren … Als es dann auch noch technische Probleme gab, habe ich mir eine Linhof Technika gekauft, eine Laufbodenkamera, die deutlich leichter ist. Das war ein großer Fortschritt. Auch hier muss ich mit einem Einstelltuch arbeiten, um das Bild auf der Mattscheibe erkennen zu können. Wenn ich dann im Sturm hinter der Kamera stehe und sich mir das schwarze Tuch um den Kopf wickelt, komme ich mir manchmal vor wie in einem Slapstick aus einem Dick-und-Doof-Film. Das funktioniert immer noch genauso wie im 19. Jahrhundert – nur, dass ich keinen Zylinder aufsetze.
Dieses Kameraprinzip scheint mir der Sache gerecht zu werden – darin drückt sich eine gewisse Bescheidenheit aus. Der fotografierte Platz hat keine Möglichkeit, sich großartiger darzustellen, als er ist. Man stellt sich ihm fast mit dem bloßen Auge gegenüber, darin liegt auch eine gewisse Nacktheit. Wenn ich hingegen eine Digitalkamera verwende, steht doch eine erhebliche Übersetzungsleistung zwischen mir und der Welt.
Ja – wobei natürlich jede zweidimensionale Abbildung bereits eine starke Abstraktion ist. Das Schöne ist, dass ich am Ende ein Bild, ein Original in Händen halte, und nicht einen Datensatz auf einem Datenträger, der wiederum ein Gerät erfordert, um das eigentliche Bild sichtbar zu machen.
Die »Nacktheit« liegt vielleicht eher darin, Bilder mit relativ schwacher Aussage nicht durch irgendwelche Tricks spannend zu machen, sondern sie als schwach auszusortieren. Deshalb arbeite ich nicht mit extremen Brennweiten, verwende kein künstliches Licht und vor allem keine Effektfilter – außer einem Polfilter, der das Streulicht reduziert und dadurch die Farben intensiviert. Es geht mir darum, mit einem »normalen« Blick, der etwa dem des menschlichen Auges entspricht, die Stärken des Ortes zu entdecken. Was Sie auf meinen Bildern sehen, ist also auch so da gewesen. Ich erzeuge nie künstlich eine Atmosphäre im Bild.
Besonders im Fernsehen sieht man heute oft Verlaufsfilter, die über den Himmel gelegt werden, um die Kontraste zu mildern. Das hat auf den ersten Blick einen fantastischen Effekt, aber bald werden die Bilder langweilig.
Wie reagieren Menschen, die Sie beim Fotografieren der Ahnentempel entdecken? Sie dürften ja bemerken, dass hier kein Pressefotograf am Werk ist.
Mit so einem altmodischen, großen Fotogerät falle ich natürlich auf und wecke die Neugier der Leute. Viele sind interessiert und fragen, ob ich für eine Zeitung arbeite oder einen Film drehe. Manche verstehen zunächst mein Motiv nicht. Wenn ich es ihnen aber erkläre, sind sie sehr aufgeschlossen und meinen, es sei eine wichtige Sache, diese Orte zu zeigen.
Kommen Sie nicht auch über die Bedeutung der Plätze mit den Menschen ins Gespräch?
Auch das geschieht ab und zu, vor allem, wenn ich Menschen treffe, die zum ersten Mal so einen Platz besuchen. Viele haben schon von sogenannten Kraftplätzen gehört und suchen nach eigenen Erfahrungen. Es scheint ein wachsendes Bedürfnis zu geben, hinauszugehen und nachzusehen, wo wir eigentlich sind und was wir hier machen. Dieses Streben nach Erkenntnis haben die meisten delegiert, aber dort liegt meiner Meinung nach eine wichtige Aufgabe. In diesem ganz einfachen Bereich von persönlicher Welterfahrung hatten uns die Alten eine Menge voraus. Solche Gedanken lassen sich im Gespräch über das Fotografieren eines alten Ortes ganz gut austauschen.
Haben Sie jemals schwarzmagische Spuren an den Orten gefunden?
Sehr selten. Ich habe einmal ein totes Kaninchen in einer Kammer gesehen, und es gibt einige wenige Orte, die eine wirklich »schwarze« Ausstrahlung haben. – Auf der Osterinsel habe ich einmal einen Stein berührt, gespannt, ob ich Kontakt zu dem Platz bekommen könnte. Es hat mich richtig weggeschleudert, so negativ war er aufgeladen. Nun weiß man ja auch von kannibalischen Ritualen, und wer weiß, was dort geschehen ist …
Ihr eigener Anspruch – ist es Dokumentation, künstlerische Fotografie oder Kunst?
Ich sehe alle drei Aspekte in der Arbeit. Die einzelnen Bilder haben einen stark dokumentarischen Charakter durch die Anbindung an den konkreten Ort. Mir liegt etwas an der Wahrhaftigkeit, die die Fotografie hat, wenn man nicht zu stark manipuliert. Ich finde, gute Fotografien beziehen ihre Kraft aus diesem Spannungsfeld von Dokumentation und Ästhetik. Damit sind wir beim zweiten Punkt: Für die Auswahl der Motive und der Bilder waren ästhetische Kriterien maßgeblich. Ich habe immer nach starken Bildern gesucht, nach Archetypen, nach Motiven, die über sich selbst hinausweisen. Die eigentliche künstlerische Arbeit liegt dann in dieser Bewusstmachung ungewohnter Dimensionen.
Viele Menschen wollen ihrem Gefühl künstlerisch Ausdruck verleihen, aber nur wenige bemühen sich darum, dem Gefühl durch Ausbildung und Bildung ein präzises Ausdrucksmittel zur Seite zu stellen. Das ist ein weiter Weg, den nur wenige gehen wollen.
Ohne solides Handwerk kommt keine gute Fotografie heraus. Man muss sich auf das Motiv konzentrieren können, ohne ständig über den Apparat nachdenken zu müssen. Er muss ein Teil deiner selbst werden, du musst die Technik möglichst im Schlaf beherrschen – und wissen, was überhaupt möglich ist. Und du musst bereit sein, dich aus der Situation zu lösen, dich von deinem Motiv zu trennen, um es in ein zweidimensionales Bild zu übersetzen.
Aber die Entscheidung für ein Motiv kann man natürlich nicht lernen, das bleibt intuitiv, die Inspiration dafür kommt aus einer tieferen Schicht …
Entweder man sieht die Welt als Künstler, oder nicht … Man kommt an einen Ort und sieht das strukturierte Element. Es reicht nicht aus, nur abzuzeichnen oder abzubilden. Aus dem komponierten Bild spricht etwas, das eine nichtdingliche Tiefe hat, so dass der Betrachter sagt: Das rührt mich an.
Ich bin glücklich, wenn ich spüre, dass das so beim Betrachter ankommt. Wenn ich zum Fotografieren an einen Ort komme, versuche ich herauszufinden, was mich dort fasziniert. Es geht darum, diesen Eindruck möglichst zu verdichten, seine Essenz einzufangen. Gleichzeitig geht es um die Organisation des Bildes, die Gewichtung der Linien, Flächen und Farben, die Richtungen und Beziehungen zwischen den Bildelementen.
Geschieht das, während Sie auf die Mattscheibe schauen?
Ja, wenn ich eine Idee habe, schaue ich durch die Kamera und stelle fest, ob die Idee funktioniert. Oft sieht man erst dann, dass von dem, was in der Realität so großartig ist, auf der Mattscheibe gar nichts zu sehen ist …
Außerdem steht das Bild dort ja auf dem Kopf. Da ich aber schon so lange damit arbeite, ist es kein Bruch mehr. Und es auf den Kopf zu stellen ist auch ein Qualitätstest. Wenn die Komposition selbst dann noch stimmt, ist das Bild gut. Insofern ist der Kopfstand auch ein guter Filter für die gewählten Motive.
Dann arbeiten Sie weiter, stellen die Schärfe ein …
Wenn ich weiß, worauf es ankommt, versuche ich, das herauszuarbeiten. Unwichtige oder störende Teile, wie die zerschossenen Panzer in der Umgebung von Putlos, kann ich in der Unschärfe verschwinden lassen. Und ich kann eben die Schärfenebene auch horizontal durch den Raum legen, wenn es nötig ist.
Wenn die Lichtsituation schwierig und genug Zeit ist, mache ich manchmal ein Polaroid, um die Belichtung zu prüfen. Oft ist es aber so bewegt, dass ich nicht dazu komme, weil dann das Licht schon wieder weg wäre. Also: Messen, Filmkassette einlegen und – Schuss!
Der Betrachter fragt sich: Wie hat der Fotograf das Geheimnis des Ortes eingefangen? Kommt es auch vor, dass das Foto etwas ganz anderes vermittelt als der Ort bei einem Besuch? Man sieht den Ausschnitt in der Natur ja niemals so begrenzt wie auf einem Bild.
Ja, es ist auch für mich immer wieder überraschend, was wirklich dabei herauskommt. Manchmal entdecke ich völlig neue Aspekte im Bild.
Wenn das Foto nicht manipuliert wird, hat der Geist des Ortes auch eine Chance, in das Bild zu schlüpfen.
Die Bilder sollen als Bilder funktionieren – und lassen sich doch nicht vom Ort und dem Motiv trennen. Im besten Fall kann ich im Geist beim Betrachten des zweidimensionalen Fotos den Schritt zurück zur dreidimensionalen Realität machen und so auch Kontakt zu dem Platz aufnehmen. Diese Transparenz haben die Fotos nur, wenn sie weder bei der Aufnahme noch später digital manipuliert werden. Wie dieses transzendente Element, das Sie ansprechen, einfließt, entzieht sich aber der Beschreibung. Es gibt immer wieder Stellen, an denen ich sozusagen innerlich einraste und weiß: Da ist etwas.
Das wäre vergleichbar mit einem Wünschelrutengänger; er hat an einer bestimmten Stelle eine Reaktion.
Ja. Neulich ging das einmal so weit, dass ich schon abgebaut und eingepackt hatte; ich wollte endlich nach Hause. Aber an einem Punkt musste ich mich plötzlich noch einmal umdrehen. Ich habe dann wieder alles ausgepackt, die Kamera aufgebaut und ein Foto gemacht.
Wenn Sie mich mit einem Rutengänger vergleichen, frage ich mich, was den »Ausschlag« auslöst. Ein Bild ist ja kein messbarer Reiz an einem bestimmten Ort. Es scheint mehr eine Kommunikation mit einer Art Bewusstsein zu sein, das mir dann auf die Schulter tippt und sagt: Guck doch hier noch mal.
Wenn man sich in den Dienst einer Sache stellt, dann entstehen die Dinge in einer Beziehung, und diese ist sicherlich keine Einbahnstraße.
Ja, das ist wie bei einem Portrait. Diese Vorgehensweise ist nicht an ein Thema gebunden.
Ein hohes Maß an Empathie ist auf jeden Fall notwendig, um so eine Botschaft zu vermitteln. Empathie entsteht in Lebenszusammenhängen, ein Gegenüber ist kein Objekt – es ist ein Subjekt. Insofern sind Ihre Motive jeweils zu einem Bild arrangierte Biotope.
Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Bilder. Ich betrachte alle Elemente als gleichwertig und aufeinander bezogen. Die Gesten der Bäume, die Launen des Wetters, die Meditation der Steine – das sind alles Ideen und Regungen, die genauso in uns sind. Es gibt nichts »da draußen« – übrigens ein dummes Klischee –, was nicht auch in uns wäre und das wir nicht verstehen könnten. Alles spricht, und es ist an uns, zuzuhören.
Bei guten Bildern habe ich oft das Gefühl: Der Fotograf hat alles Technische eingerichtet, dann ist er verschwunden. Und bevor er zurückkommt, ist das Bild in der Kamera. Wenn das Ego in dem Kristallisationsmoment, in dem das Bild sich verewigt, etwas Überpersönlichem Raum gibt, erlöst sich bei der Wiedergabe des Bildes dieser überpersönliche Aspekt.
Bilder mit dieser Transparenz empfinde ich als die besten. Und sie sind sehr wohltuend für den Betrachter, dem der Blick nicht durch die Vorstellungen des Fotografen verstellt wird. Dieser meditative Aspekt ist für meine Arbeit sehr wichtig. Ich möchte mich in der Welt und eins mit der Welt erleben.
Dann können sich in dem Bild auch unterschiedliche Ebenen ausdrücken, womöglich auch das Ahnenfeld der Menschen, die den Platz gestaltet haben.
Es wäre schön, wenn das mitschwingt. Ich entdecke da auch die Indianer wieder, die mich als Kind so fasziniert haben. Diese verlachten, vertriebenen, hingemordeten Menschen, die eins waren mit der Welt, die etwas wussten über ihren Platz auf der Erde, die Zugang hatten zu anderen Bewusstseinszuständen, für die Bäume und Tiere Verwandte waren – da ist unendlich viel zerstört worden und verloren gegangen. All das hat es so oder ähnlich eben auch hier gegeben, auch unsere Vorfahren haben so gelebt. Wir sind aus dieser Einheit des Seins herausgefallen, müssen uns dieser Dinge neu vergewissern. Ich möchte diese Orte und Momente auch in mir neu entdecken und bewahren, diese ferne Erinnerung an eine Einheit, diese Idee von menschlicher Bestimmung.
Aber es ist wohl nicht die heile Welt, die Sie suchen, sondern eine zeitgemäße Art der Verbundenheit.
Ich leide nicht unter der Illusion, dass man damals in einer heilen Welt lebte. Es war ein sehr hartes Leben. An den Knochen der bronzezeitlichen Moorleichen in Schleswig etwa ist abzulesen, dass diese Leute mehrmals knapp dem Hungertod entgangen sind.
Es liegt eine Gefahr darin, die Vergangenheit zu glorifizieren, zu meinen, es sei das goldene Zeitalter gewesen. Aber vielleicht können wir doch von den Anfängen der Kultur etwas über unsere Verbindung mit der Natur lernen.
Das Zurückfinden in diese Zusammenhänge ist die Herausforderung der heutigen Zeit. Früher brauchte es kein Zurückfinden, es war selbstverständlich, man war noch nicht getrennt. Heute treibt uns diese Sehnsucht nach dem Zustand der Einheit.
Diesem Impuls nachzugehen ist auch etwas, das mir Spaß macht, wenn ich zu den Megalithorten unterwegs bin. Ich klinke mich aus dem heutigen System mit all seinen Normen und Begrenzungen aus und folge den Strukturen der alten Kultur. Das ist sehr entspannend.
Mir geht es so, dass mir, selbst wenn ich mich nur gedanklich mit einem dieser Orte verknüpfe, dessen Potenzial als Ressource zufließt. Das scheint ganz einfach zu sein, wenn man das Prinzip der Verbundenheit verstanden hat.
Der Schatz, den wir uns in der Aufklärung erworben haben, die individuelle Freiheit und das selbständige, rationale Denken, muss unbedingt mit dem zusammenfinden, was eine Schicht tiefer liegt, was dem verstandesmäßigen Denken zugrundeliegt. Vielleicht ist das der Grund, warum die Themen, die von einer Beschäftigung mit der Megalithkultur aufgeworfen werden, heute so eine Brisanz haben.
Dazu gehört für mich das Thema der Ahnen. Gibt es die Möglichkeit, durch Zeit und Raum mit den Ahnen Verbindung aufzunehmen? Haben Sie Ahnen?
Ich glaube, ich habe sie unbewusst immer in der Ferne gesucht, bei den Indianern, auf der Osterinsel, in Großbritannien. Als mir das klar wurde, spürte ich den Impuls, nachzusehen, was denn meine direkten Vorfahren hier eigentlich getrieben haben …
In verschiedenen Zusammenhängen gehe ich zurzeit intensiv mit dem Ahnen-Thema um, und aus dieser Beschäftigung hat sich eine neue Qualität der Betrachtung entwickelt. In meiner privaten Großfamilie sind wir heutigen Älteren schon die lebenden Ahnen der Jungen. Wir experimentieren mit dem angelsächsischen Begriff der »Elders«, der unser Wort »Eltern« transzendiert und nicht an das berüchtigte »Ahnenerbe« im Dritten Reich erinnert.
Der gesamte Themenkomplex ist durch den Missbrauch im Dritten Reich schwer belastet, man kann die Wörter kaum in den Mund nehmen. Das hat auch der Rezeption der Megalithkultur bei uns sehr geschadet, weil viele Deutsche unsere Vorgeschichte nur mit dem Germanenkult der Nazis identifizieren. Erschwerend kommen die »Forschungen« über Kultorte und Geomantie im Dritten Reich hinzu, die auch diese Bereiche lange diskreditiert haben. Auch die Runen gehören zu den Opfern, dabei sind sie ein Schlüssel zu dem großen mythologischen Erbe des europäischen Nordens.
Die Beziehung zu den Vorfahren oder gar zu so etwas wie Ahnen ist in unserer heutigen Kultur fast vollständig gebrochen. Andererseits ist es noch nicht lange her, seit die junge Generation ihre Alten alleine lässt. Heute leben wir in einer Gesellschaft, die nicht vorsieht, dass die Eltern im nahen Umfeld der Nachkommen alt werden. Das ist ganz anders, als wenn man in einem sozialen Kontinuum aufwächst, in dem man am Schluss von denen versorgt wird, die man selbst am Anfang versorgt hat. Heute fühlt man sich mit kaum jemandem, der vor einem war, verbunden. Unsere Zeit müsste sich mit den Themenkomplexen von Vergangenheit, Tradition und Ahnen auseinander setzen, nicht im romantischen oder gar heroischen Sinn, sondern schlicht um zu verstehen: Ich stehe auf den Schultern jemandes anderen.
Im Grunde ist es kindlich, wie wir damit umgehen. Für ein Kind sind alle Dinge, die es umgeben, einfach da. Aber irgendwann wird einem doch bewusst, dass all die Werkzeuge und Kulturgüter, die wir benutzen, einmal von jemandem gefunden oder erfunden worden sind. Wir schöpfen ständig aus diesem riesigen Fundus an Kreativität. Das ist eine lange Traditionslinie.
Dem Ahnen-Thema kann man sich nur mit Schwierigkeiten annähern. Ich wurde persönlich damit konfrontiert, als ich gemeinsam mit meiner Großfamilie zum ersten Mal Land kaufte, sesshaft geworden bin. Kann ich ein Ahne dieses Landes werden? Wird man das bereits zu Lebzeiten? Jeder Schritt, den wir hier bewusst machen, bringt uns näher an das Ahnen-Dasein. Weil das Thema so viel Relevanz in meinem Leben bekommen hat, gewann auch meine Beziehung zu den alten Megalithplätzen eine neue, lebendige Qualität. Ich möchte mich frei mit dem Thema der Ahnen beschäftigen können, ohne dass mir Prärationalismus oder Schlimmeres vorgeworfen wird.
Die Beschäftigung mit den Megalithorten könnte ein Weg dorthin sein. Denn man fragt sich doch: Wer hat hier warum seinen Ahnen etwas so Eindrucksvolles gebaut, aber selbst in einfachen Holzhäusern gelebt? Die Antworten lassen sich nur erahnen, aber man kann zumindest einen inneren Raum schaffen, in dem sich solche Fragen kreativ bewegen lassen.
Das Prozesshafte des eigenen Lebens erscheint durch eine solche Betrachtung sinnvoller. Wenn man sich als Teil eines größeren Prozesses versteht, kann man es leichter hinnehmen, dass die Frage nach dem »Warum« im Leben so selten beantwortet wird. Die Plätze haben somit nichts Altertümliches an sich, sondern einen aktuellen Wert.
Ja – und gar nichts Totes. Manche Leute, denen ich erzählt habe, dass ich Hünengräber fotografiere, meinten, das sei doch etwas furchtbar Morbides. Aber die Plätze fühlen sich oft eher leicht und luftig an.
Es ist faszinierend, dass die schweren Steine etwas so Leichtes an sich haben. Das ist wie beim Tai Chi: Wenn du loslässt und ganz schwer wirst, setzt du etwas ganz Leichtes frei und richtest dich auf.
In Irland kennen wir einen kleinen Ahnentempel, den wir »Lachdolmen« genannt haben. Ein spezieller Stein darin ist übersät mit kleinen Quarzkristallen. Sobald sich Menschen an diesen Stein setzen, werden sie heiter und fangen an zu lachen – alles andere als Begräbnisstimmung! Zu einer schamanischen Kultur, wie es diejenige der Jungsteinzeit in Europa nach allem, was wir wissen, war, gehört die ekstatische Transition in die Anderswelt. Dieser Geisteszustand bedarf einer Leichtigkeit.
An vielen Schalensteinen hat man erhöhte Radioaktivität gemessen, die das Bewusstsein womöglich doch beeinflussen kann. Auch Paul Devereux weist darauf hin. Ich persönlich spüre dort oft eine feine euphorisierende Wirkung. Ist es nicht erstaunlich, wie diese Anlagen nach Jahrtausenden noch funktionieren?
Selbst die Art, wie ich mich an den Plätzen bewege, die Art, wie ich sie betrete, wie ich sie umkreise, wie ich sie wahrnehme, wie sie mein Weltbild beeinflussen – das dürfte eben auch dem sehr ähnlich sein, was die Menschen früher dort gemacht haben.
Was können wir heute bauen, das in 6000 Jahren noch irgendjemanden bewegen wird?
Das frage ich mich auch. Bauwerke müssen wohl archetypische Bilder wachrufen, damit sie ihre Botschaft über die Zeiten hinweg transportieren können.
Die Hügel, Dolmen und Steinkreise sind ja solche Archetypen. Der Berg, die Höhle, das Tor – diese Bilder sind einerseits mit den Urbildern von Fruchtbarkeits- und Erdgöttinnen verknüpft, andererseits auch mit den schamanischen Erfahrungen der Menschen. Im konkreten Bauwerk verbinden sich diese Bilder mit dem Ort und den Materialien, die man dort findet, und werden dadurch selbst konkret.
Der große Unterschied zu damals liegt allerdings in unserem veränderten Bewusstsein.
Ich versuche manchmal, eine Brücke zu schlagen mit der Frage: Wie sehen Erzeugnisse anderer Ethnien aus? Dabei fällt mir ein Gegensatz besonders auf: Wir versuchen, in ein Bauwerk »Ästhetik« zu bringen, traditionelle Kulturen hingegen geben dem Bauwerk eine »Bedeutung«, die in sich selbst so stimmig ist, dass selbst das »Naive« einen Kunstcharakter bekommt. Das sogenannte Rohe ist ja dann nicht roh, sondern es hat Bedeutung. Insofern hätte man ein Megalithbauwerk nicht einmal als neu empfunden, sondern schlichtweg als Ausdruck dessen, was es bedeutet. Die Beschäftigung mit indigenen Kulturen heute hilft, die Vorstellung zu verlassen, wir könnten mit unserem heutigen Bewusstsein ohne weiteres nachvollziehen, wie sich die Welt für unsere Vorfahren angefühlt haben mag. Darum können wir auch den Eindruck, den die Bauwerke damals auf die Menschen machten, mit unserem heutigen Bewusstsein kaum reproduzieren.
Aber vielleicht können wir auf der intuitiven Ebene einen Zugang erhalten. Das Bewusstsein der damaligen Menschen ist vielleicht als sehr tiefe Schicht noch in unserem heutigen Bewusstsein angelegt. Insofern kann man vielleicht mit einem archaischen Bewusstsein in Resonanz geraten, ohne genau zu wissen, was damals war.
Die Ethnologie fördert viele intellektuelle Erkenntnisse darüber zutage, wie man in so einem magischen Bewusstsein lebt – übrigens ein interessantes Paradox –, und ich denke, dass auch wir heute bis zu einem gewissen Grad in ein solches Bewusstsein einsteigen können. Es wird ja oft behauptet, unser heutiges, rational geprägtes Bewusstsein sei der Gipfel einer linear verlaufenen Bewusstseinsentwicklung, und das archaische, magische und mythische Bewusstsein bildeten »Vorstufen« auf diesem Weg. Stillschweigend wird wohl angenommen, jegliche Bewusstseinsentwicklung müsse unweigerlich zum Denken eines heutigen Mitteleuropäers oder Nordamerikaners führen. Das halte ich für überheblich. Womöglich ist das Bewusstsein traditioneller Völker in Bereichen, die wir gar nicht wahrnehmen, viel weiter entwickelt als unseres. Insofern finde ich es auch problematisch, über die Qualität des Bewusstseins unserer jungsteinzeitlichen Vorfahren zu urteilen.
Inzwischen haben wir ja zum Glück gelernt, etwas behutsamer mit anderen Menschen umzugehen. Aber auch heute gehen ja noch ganze Völker unter und mit ihnen eine Kultur, die vielleicht deutlich älter ist als unsere. In Patagonien gab es einen sehr »primitiv« lebenden Stamm, der einen viel größeren Wortschatz hatte als alle heute bekannten Sprachen.
Beurteilt man andere Kulturen anhand von »Entwicklungsstufen«, etwa wie Don Beck oder Ken Wilber, wird man dem Wesen jener Kulturen nicht gerecht. Diese verbreitete Überheblichkeit bestärkt mich persönlich in dem Impuls, mich mit der Vorgeschichte zu befassen. Jene Zeit war in keiner Weise nur »prä…« zu etwas, das wir uns ans Revers heften könnten. Gerade die Gegenwart zeigt uns die verheerenden Auswirkungen der Verdrängung wesentlicher Werte jener Kulturen durch den Modernismus – der ja selbst nur eine Reaktion auf die Vereinnahmung des Alten durch den Traditionalismus war.
Deshalb ist die Beschäftigung mit diesen Dingen auch so heilsam. Man beginnt wieder, Erfahrungen mit der Landschaft, der Erde und dem Kosmos zu machen. Und es ist mir auch wichtig, selbst spirituelle und religiöse Erfahrungen zu machen und nicht nur auf fremde Vorstellungen angewiesen zu sein.
Dann bekommt man die Chance, sich und die Menschheit als einen Teil der Erde begreifen zu können, als ein Organ der Erde, mit dem das Leben sich seiner selbst bewusst werden will. Wir sind die Welt, die sich selbst feiert.
Erschienen in: Johannes Groht, Tempel der Ahnen – Megalithbauten in Norddeutschland; herausgegeben von Lara Mallien und Johannes Heimrath; AT Verlag Baden und München, 2005